Messen und Modellieren von Energieflüssen
Wider Klischees
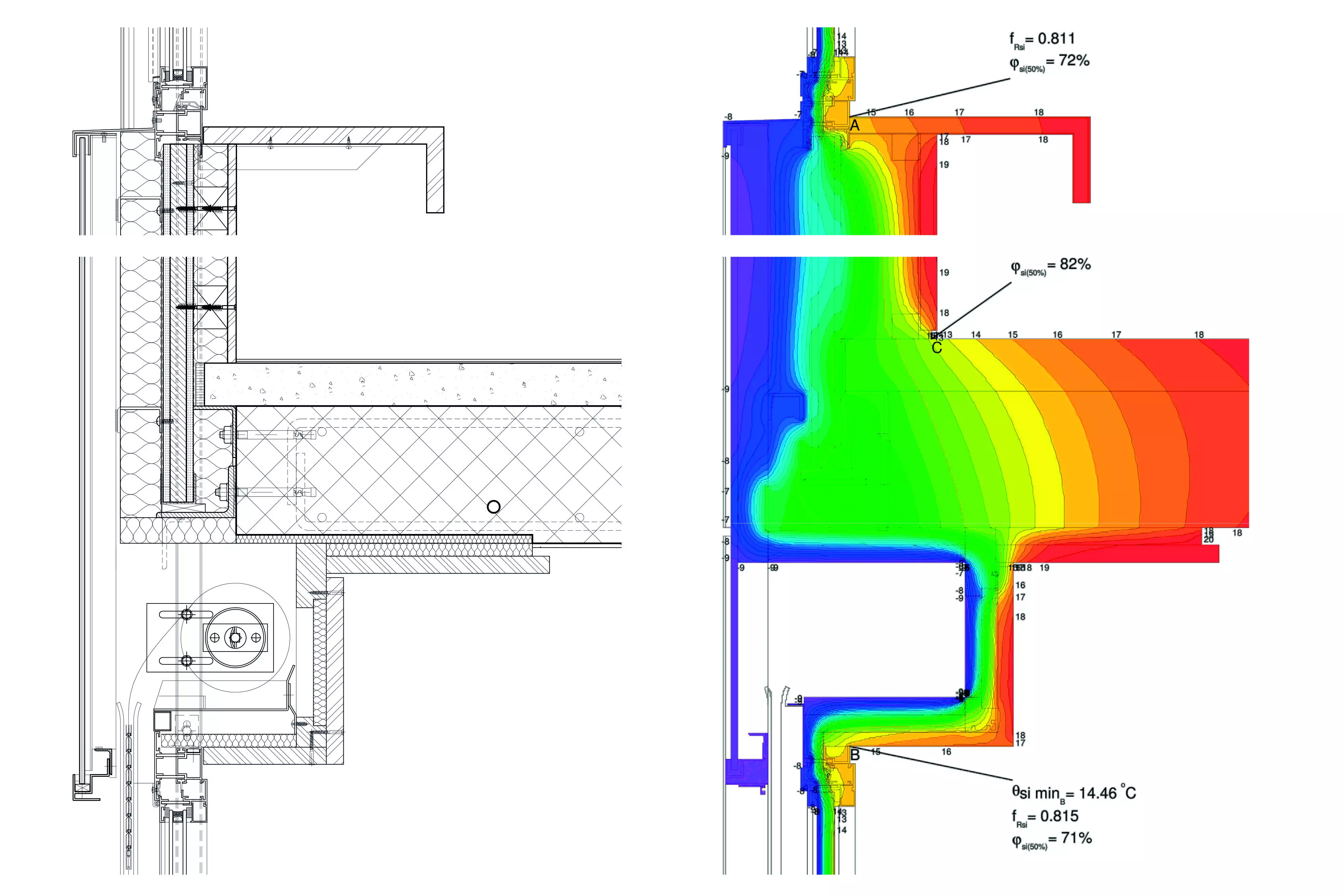
Auf einen Blick
- Projektleiter/in : Dr. Jürg Graser
- Stellv. Projektleiter/in : Prof. Astrid Staufer
- Projektteam : Mario Frei, Mathias Klingler, Christian Meier, Dr. Sabine von Fischer
- Projektstatus : abgeschlossen
- Drittmittelgeber : Interne Förderung (ZHAW Forschungsschwerpunkt «Energie»)
- Projektpartner : Meletta Strebel Architekten AG, Graser Architekten AG, Pensionskasse der Stadt Biel, Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein SIA
- Kontaktperson : Jürg Graser
Beschreibung
Ausgangslage
Energie ist das Thema unserer Zeit. Der Bausektor
nimmt mit Erstellung und Betrieb 44 % des gesamten
schweizerischen Energieverbrauchs in Anspruch. Zur Erreichung der
geplanten Energiestrategie 2050 des Bundes muss auch zwingend der
Energiebedarf im Gebäudepark reduziert werden. So entstehen für den
Bausektor neue Normen und Vorschriften, welche laufend die
Ausgangslage für den Architekten und Planer verändern, nicht immer
zu dessen Vorteil. Viele Jahre haben sich Architektinnen und
Architekten nicht oder zu wenig mit Energiefragen beschäftigt. Die
klassischen Architekturthemen Raum, Konstruktion, Funktion und Form
dominieren. Das führt zwangsläufig zu einem von der Politik oder
von Fachingenieuren geführten Energiediskurs. Wie Jahrringe legt
sich die Wärmedämmung Jahr um Jahr, Zentimeter um Zentimeter zu und
die Haustechnik nimmt im übertragenen und buchstäblichen Sinn immer
mehr Raum ein. Die Energiekultur ist an die Spezialisten abgetreten
worden.
Die kombinierte Methode von Messen und Modellieren versucht hier
eine Lücke zu schliessen. Anhand von zwei architektonisch
wertvollen Gebäuden wurde eine Datensatz erarbeitet um aufzuzeigen,
dass Qualifizieren und Quantifizieren gleichermassen wichtig ist.
Die Untersuchung fokussiert nicht einseitig das Thema Energie,
sondern untersucht sie in ihrer Interaktion mit Architektur /
Ausdruck und Material / Konstruktion. Die Arbeit soll eine neue
Energiekultur mit grösseren Spielräumen fördern. Die Architektinnen
und Architekten sollen den Dialog wieder aufnehmen und ihre
Kompetenz als Generalist einbringen. Der «Dialog der Technik» soll
den seit Jahren erfolgreichen «Dialog der Konstrukteure» erweitern
und bereichern.
Untersucht wurden ein Mehrfamilienhaus mit Erstellungsjahr 1872 an
der Florastrasse 54 in Zürich und ein Wohnhochhaus «Tour de la
Champagne» in Biel aus dem Jahr 1968. Beide Objekte entsprechend
der charakteristischen Konstruktionsweise ihrer Zeit.
Für die Analyse wurde sowohl mit der gängigen Modellrechnung – Norm
SIA 380/1 – der Heizwärmebedarf simuliert, als auch direkt am
Objekt gemessen. Um die Funktionsweise der Gebäude besser
einordordnen zu können, wurden diese zusätzlich in Zeitschichten
aufgeteilt. Dies ermöglicht es die Sanierungs- und
Technologiehistorie in einen Kontext zu setzen.
Fragestellungen
Fragestellung Florastrasse:
Wieso führt der Wärmedämmputz nach der Sanierung nicht zur
berechneten Reduktion des Heizwärmebedarfs?
Fragestellungen Tour de la Champagne: Der Ersatz der originalen
Aluminium-Glas-Vorhangfassade ist nicht erforderlich, um den
heutigen geforderten Heizwärmebedarf zu erreichen.
Anhand der Fragen: «Was leistet das Haus? Was leistet die
Konstruktion? Was leistet die Haustechnik?», werden die
Wechselwirkungen zwischen den architektonischen und energetischen
Entscheiden am einzelnen Bauteil aufgezeigt.
Fazit
Von der ursprünglichen Absicht möglichst viele Daten am Objekt zu
messen, ist man während der Arbeit abgekommen. Mehr Zahlen führten
nicht zwingend zu einer Vergrösserung der Erkenntnisse. In der
Weiterbearbeitung wurden die Messdaten in erster Linie auf die
Nutzung der bereits ausreichend genauen Verbrauchsdaten der
Energierechnungen reduziert. Bestätigt wurde unter anderem die
«Performance gap» welche in erster Linie in den zu optimistischen
berechneten Prognosen der Sanierungsvarianten aufgefallen sind. Die
Abweichungen sind neben fehlerhaften Annahmen auch der Unkenntnis
von Lebensgewohnheit, Bauteilaufbauten und Standardwerten
geschuldet. Bei Sanierungen an bestehenden Objekten ist der Weg
über die Messung zur Modellierung zielführend. Die Forschungsarbeit
zeigte auch, dass sich hinter dem Einzelwert Qh (kWh/m2a) viel mehr
versteckt, als bloss eine Zahl. Qh steht immer in unmittelbarer
Abhängigkeit von Architektur/ Ausdruck und Material/Konstruktion.
Messen und Modellieren zeigt, dass eine einseitige Ausrichtung der
Architektur nur auf Energiethemen zu einem Zielkonflikt führt.
Die Studie soll helfen Klischees, die sich fest in den Köpfen von
Investoren, Planer und Nutzer festgesetzt haben sichtbar zu machen
und so die verlorenen Handlungsspielräume der Architekten
wiederzuerlangen.
Publikationen
-
Staufer, Astrid; Graser, Jürg; et al.,
2017.
Wider Klischees : Messen und Modellieren im sich wandelnden Fokus der Baukultur.
In:
Peer Review durch die ZHAW-Forschungsdelegierten und externe Fachexperten, ZHAW Winterthur, Halle 180, 13. Juli 2017.