Sexwork und Corona
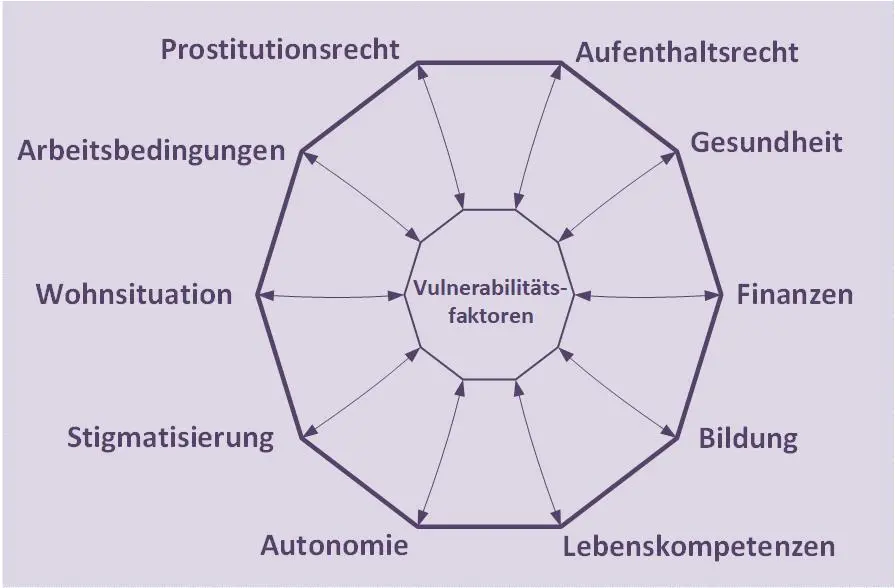
Auf einen Blick
- Projektleiter/in : Michael Herzig
- Projektteam : Nina Brüesch, Nadine Khater, Manuela Müller, Carmen Steiner, Anja Trümpy, Lisa Tschumi
- Projektvolumen : CHF 60'000
- Projektstatus : abgeschlossen
- Drittmittelgeber : Stiftung (Stiftung für soziale Arbeit), Interne Förderung
- Kontaktperson : Michael Herzig
Beschreibung
Ausgangslage
Aufgrund der Corona Pandemie wurden im Kanton Zürich (Schweiz)
politische Massnahmen zu deren Eindämmung beschlossen (Zeitraum
März 2020-aktuell), welche auf die Lebenslage, die Lebenswelt sowie
die Lebensbewältigung von Sexarbeiter*innen einen grossen Einfluss
haben (z.B. Berufsverbot). Sexarbeiter*innen werden
gesellschaftlich und politisch als besondere Risikogruppe
identifiziert. Nebst den gesundheitlichen Risiken führt die
Pandemie zu finanziellen Problemen. Wenn das Einkommen wegfällt,
kein Vermögen vorhanden ist und der Zugang zu staatlichen
Erwerbsersatzansprüche (Sozialhilfe oder Ansprüche aus diversen
Sozialversicherungen) eingeschränkt oder verunmöglicht ist, z.B.
aufgrund des Aufenthaltsstatus, drohen schnell Mittellosigkeit und
Wohnungsverlust. Mediale und politische Stigmatisierung sowie
soziale Isolation erhöhen die Belastung zusätzlich.
Ziele
Das Forschungsprojekt „Sexwork und Corona“ untersucht im Kontext
der politischen Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus deren
Auswirkungen auf die Lebenslage von Sexarbeiter*innen in der Stadt
Zürich, die Lebensbewältigungsstrategien, welche sie in der
Pandemie entwickelt haben, und was dies für die Wirksamkeit der
Massnahmen zu Bekämpfung der Pandemie bedeutet.
Methode
Im empirischen Teil der Untersuchung wurden im April 2021 14
Fachpersonen aus Organisationen befragt, welche mit
Sexarbeiter*innen als Zielklientel arbeiten und diese während der
Corona-Pandemie unterstützt haben. Anhand der Aussagen der
Fachpersonen konnten erste Erkenntnisse zu den Lebenslagen,
Lebenswelten und der Lebensbewältigung von Sexarbeiter*innen
festgehalten werden. Zudem ermöglichten diese Gespräche eine erste
Einschätzung der Narrative im öffentlichen Diskurs über Sexarbeit
und Corona. Im Weiteren lieferten sie Informationen über die
Auswirkungen der Massnahmen auf die soziale und medizinische
Unterstützung von Sexarbeiter*innen und über die deshalb erfolgten
Angebotsanpassungen. Danach wurden 11 Sexarbeiter*innen befragt.
Dabei variierten Geschlecht (Frauen, Männer, Trans),
Aufenthaltsstatus (Sans-Papiers, 90-Tage-Visum für selbstständig
erwerbstätige EU-Bürger*innen, Niederlassung B oder C, Schweizer
Bürgerschaft), Herkunft (Schweiz, Deutschland, Osteuropa,
ehemaliges Jugoslawien, Südeuropa, Südamerika), Art und Form der
ausgeübten Sexarbeit (Strassensexarbeit, Escort,
Club/Bordell/Salon, Domina). Für ein Interview nicht erreicht
werden konnten Sexarbeiter*innen aus Afrika. Die Interviews
basierten auf einem Leitfaden und wurden ausnahmslos vor Ort
durchgeführt. Teilweise wurden die Interviews durch Fachpersonen
übersetzt oder von den Interviewerinnen in einer anderen Sprache
als Deutsch geführt. Dem empirischen Teil wurden eine
Literaturanalyse und eine Analyse der politischen Vorstösse
vorangestellt.
Ergebnis
Die vorliegende Untersuchung folgte dem Ansatz, Lebenslage,
Lebenswelt und Lebensbewältigungsstrategien von Sexarbeiter*innen
während der Corona-Pandemie im Kanton Zürich zu untersuchen. Das
Konzept folgt der Definition von Björn Kraus (2014), der sich dabei
auf eine etablierte Theorie innerhalb der Sozialen Arbeit von Hans
Thiersch und Lothar Bönisch bezieht. Die sogenannte
Lebensweltorientierung formuliert die These, dass
sozialarbeiterische Interventionen wirkungsvoller sind, wenn sie
sich an der Lebenswelt der Adressat*innen orientieren. In der
vorliegenden Arbeit wurde diese Prämisse auf gesundheitspolitische
Regulierungen während der Corona-Pandemie im Kanton Zürich
angewendet. Die Frage war, ob die kantonalen Massnahmen gegen die
Corona-Pandemie im Sexgewerbe auf Lebenslage, Lebenswelt und
Lebensbewältigungsmöglichkeiten von Sexarbeiter*innen abgestimmt
waren. Die Antwort lautet: Nein, es wurde nicht beachtet, dass
Massnahmen, die für die breite Bevölkerung gedacht waren, wie z.B.
die Registrierungspflicht, bei einer bestimmten Zielgruppe in einer
besonderen Lebenslage nicht funktionieren oder sogar
kontraproduktiv wirken würden. In den Interviews mit
Sexarbeiter*innen und Fachpersonen zeigte sich, dass die
Vulnerabilität von Sexarbeiter*Innen durch die Coronakrise
multidimensional bedingt war. Es waren Kombinationen verschiedener
Faktoren, welche die individuelle Lebenslage, ihre Deutung und die
Möglichkeiten zur Lebensbewältigung bestimmten. So kann nicht davon
ausgegangen werden, dass nur einzelne spezifische Faktoren (z.B.
Geschlecht, Aufenthaltsstatus, Arbeitsort) die erhöhte
Vulnerabilität ausmachen, sondern diese als Zusammenspiel
verschiedener Dimensionen aufeinander einwirken. Empfehlungen Die
empirischen Daten haben gezeigt, dass Sexarbeiter*innen stark von
den Massnahmen betroffen waren, an deren Ausarbeitung sie nicht
beteiligt waren. Gefässe zu installieren, an welchen Betroffene
sowie Fachstellen mitwirken können, um Massnahmen zu formulieren,
ist unter diesem Gesichtspunkt eine erste Empfehlung. Mitwirkung
kann sowohl die Effektivität als auch die Akzeptanz solcher
Massnahmen erhöhen. Auch der Austausch von Informationen und Ideen
zwischen Stadt, Kanton, Bund und Fachstellen, wie etwa ein runder
Tisch, wäre hilfreich gewesen. Grundsätzlich wird empfohlen, in
einem ähnlichen Fall kein Berufsverbot auszusprechen und auch nicht
allgemeine Hygienebestimmungen unabhängig von der besonderen
Situation aus das Sexgewerbe zu übertragen. Die negativen Effekte
überwiegen die positiven, insbesondere beim Versuch des
Contact-Tracings mittel Registrierung der Freier. Es wäre
sinnvoller, Massnahmen zu entwickeln, die auf die Situation im
Sexgewerbe abgestimmt sind und darum auch umgesetzt werden können.
Dazu bedarf es einer ernsthaften Auseinandersetzung der zuständigen
Behörden mit Lebenslage, Lebenswelt und
Lebensbewältigungsfähigkeiten von Sexarbeiter*innen. Das kann auch
im Austausch mit involvierten Sozialarbeiter*innen oder Fachstellen
erfolgen. Bei einer Einschränkung der Berufsausübung, wie dies beim
Arbeitsverbot der Fall war, muss der daraus entstanden
Erwerbsausfall systematisch ersetzt werden. Wird dies wie im
vorliegenden Fall nicht oder bloss punktuell gemacht, entwickeln
die verschiedenen Beteiligten ihre eigenen Überlebensstrategien.
Das kann den eigentlichen Zielen des Arbeitsverbotes zuwiderlaufen
und kontraproduktive Effekte erzeugen. Die Hilfen sollten
unbürokratisch, umfassend und insbesondere nachhaltig ausgerichtet
werden. Finanzielle Hilfen konnten zwar während der Pandemie durch
Fachstellen ausbezahlt werden, zeigten sich jedoch nicht als
nachhaltig bzw. reichten nicht für alle, die Anspruch gehabt
hätten. Die Fachstellen gerieten durch die Rollenerweiterung in
eine kontrollierende Rolle, was für den eigentlichen Auftrag
hinderlich sein kann. Weil der Regierungsrat das Verbot verordnet
hat, die Unterstützung von Sexarbeiter*innen aber Kommunen und
Privaten überlassen hat, war die Situation unübersichtlich und
unkoordiniert. Sowohl die gesetzlichen Bestimmungen als auch ihr
Vollzug müssen einheitlich und koordiniert sein. Weder das Eine
noch das Andere war während der Corona-Pandemie der Fall. Die
kantonalen Regelungen waren extrem unterschiedlich, sodass es zu
Verlagerungen von einem Kanton in andere kam. Und auch der Vollzug
war im Kanton Zürich disparat und unübersichtlich. Das erhöhte die
Wirkung der Massnahmen keinesfalls. Der Eindruck schlecht
koordinierten Vorgehens entstand nicht nur in Bezug auf die
Durchsetzung des Verbotes. Auch bei den unterstützenden
Organisationen mangelte es zuweilen an gegenseitiger Information
und Absprachen. Insbesondere hätte man sich arbeitsteilig
organisieren und so die vorhandenen Ressourcen gezielter
ausschöpfen können.
Publikationen
-
Bernhardt, Christiane; Brüesch, Nina; Freitag, Riccarda,
2022.
Stuttgart:
Werkstatt PARITÄT gemeinnützige GmbH.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-27434
-
Brüesch, Nina; Herzig, Michael; Khater, Nadine; Müller, Manuela; Steiner, Carmen; Tschumi, Lisa; Trümpy, Anja,
2021.
Auswirkungen der Massnahmen gegen die Covid-19-Pandemie auf Sexarbeit und Sexarbeitende in Zürich.
Zürich:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-3129