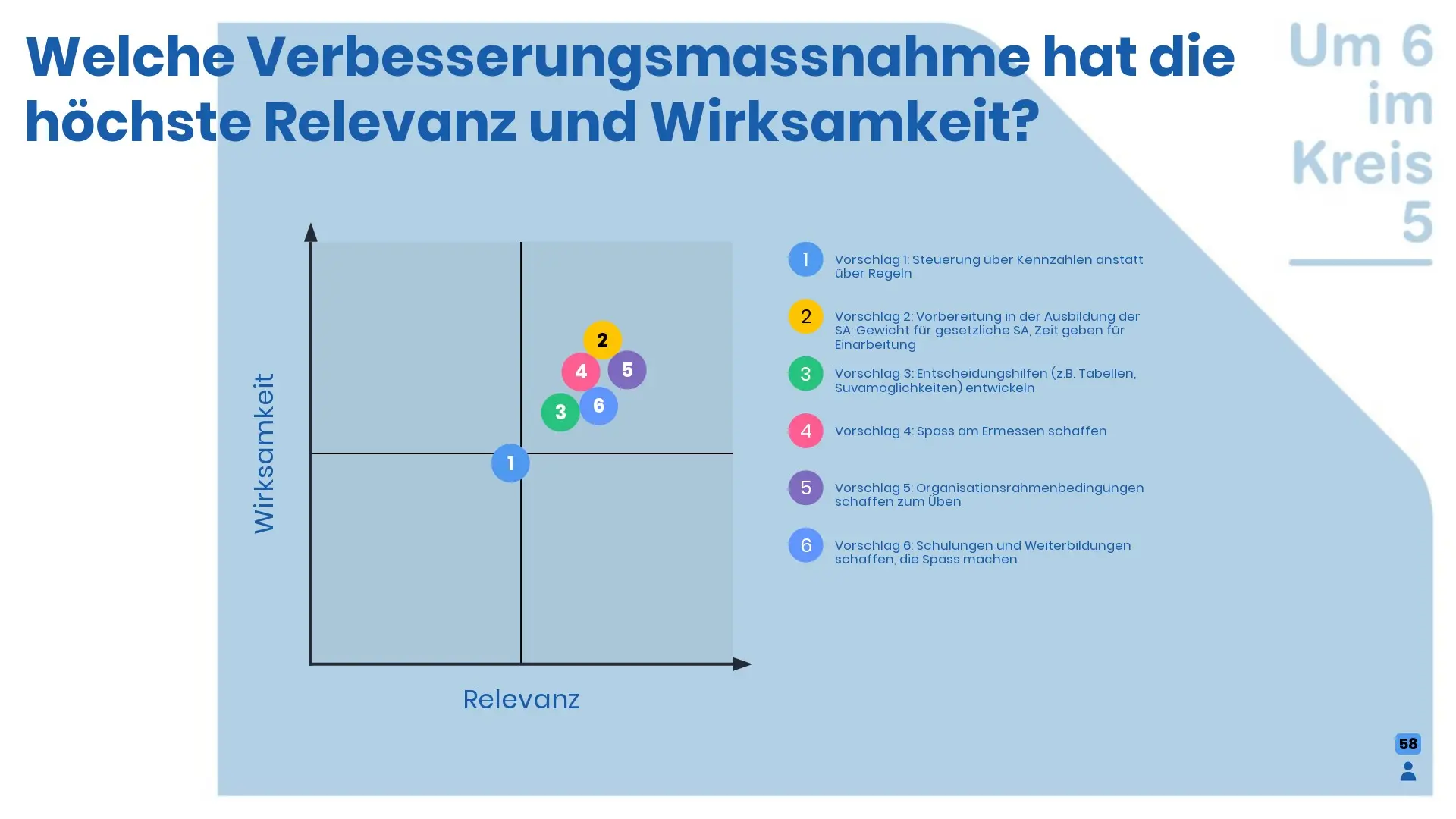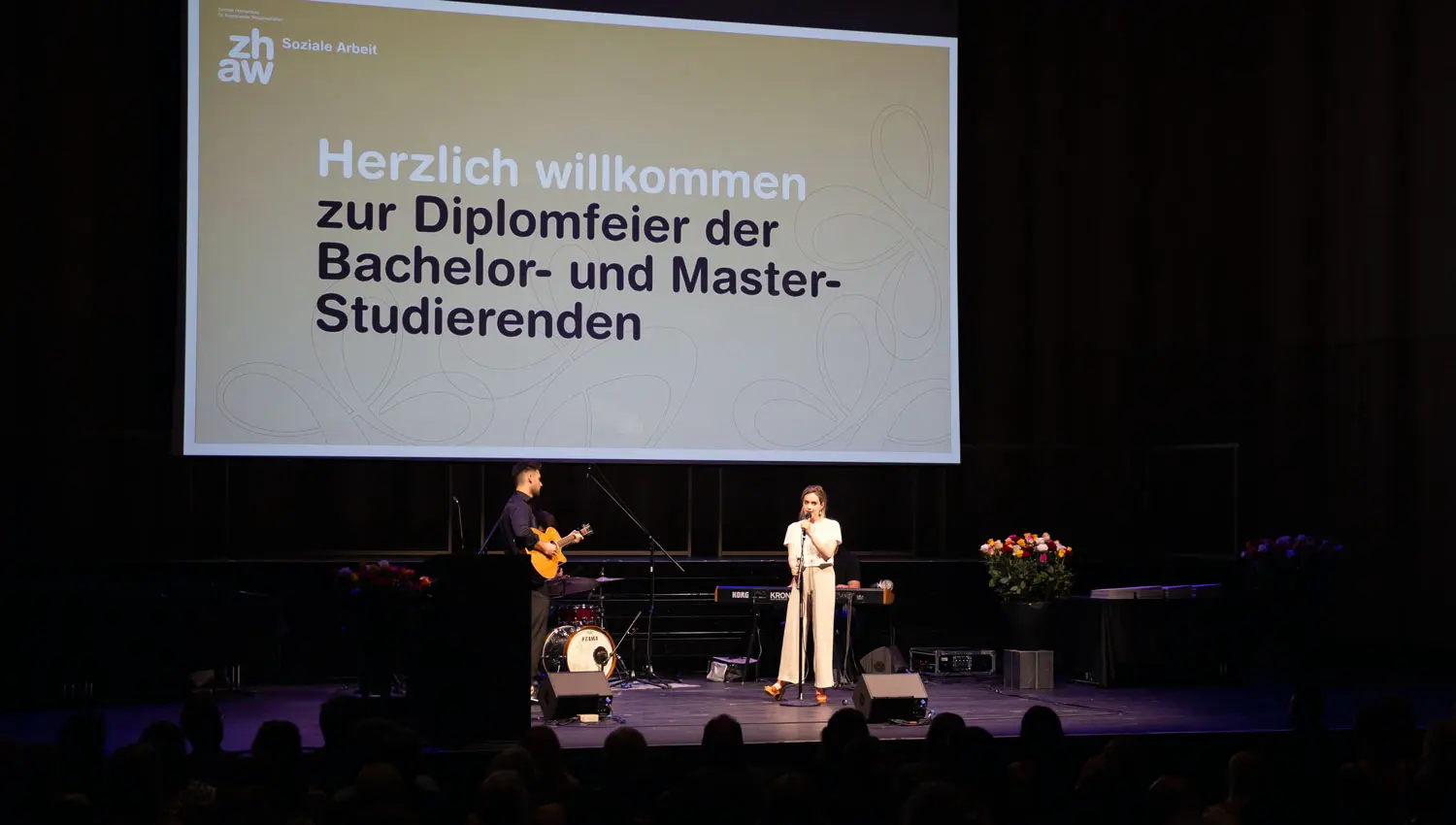News
Die Kolumne als Podcast
Wollen Sie mehr hören über Fachbegriffe der Sozialen Arbeit hören, deren Bedeutung im Laufe der Jahre durch häufigen Gebrauch vielleicht verwässert wurde?
Martin Biebricher, Co-Studiengangleiter Bachelor, spricht mit Menno Labruyère, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Digital Campus und ausgebildeter Sozialarbeiter, im gleichnamigen Podcast regelmässig über Fachbegriffe auf Abwegen.
«Sozipedia» ist eine Rubrik des ZHAW-Podcasts «sozial» und auf allen gängigen Playern verfügbar. Jetzt abonnieren – keine Episode verpassen!
Wohnung schafft Basis
In dem Sinn stellt bei «Housing First» das Wohnen vielmehr einen Ausgangspunkt dar als ein Ziel. Als Erstes wird den Adressat:innen eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt, dann erst werden individuelle und bedarfsorientierte Unterstützungsmassnahmen mit ihnen vereinbart: von der Strasse direkt in eine eigene Wohnung, ohne Vorbedingung.
In der Stadt Basel haben seit Mitte 2020 bereits über zwanzig Obdachlose ein eigenes Zuhause bekommen. Thomas Frommherz von der Heilsarmee leitet das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe und im Auftrag des Kantons. «In fast allen Fällen hat es sich bewahrheitet, dass eine sichere Wohnung den Boden schafft, um überhaupt weiterzukommen», sagt Frommherz.

Die meisten seiner Adressat:innen waren zuvor langjährig obdachlos. «Nun sind wir ihr Rückhalt, um wieder Fuss fassen zu können », weiss Frommherz. In der Praxis bedeutet das oft zuerst einmal Beistand bei der Bewältigung der Flut an Briefen, Bussbescheiden und Mahnungen, die in der Regel eintreffen, wenn es wieder eine feste Adresse gibt. Aber natürlich auch bei Krisen, Rückfällen oder finanziellen Engpässen.
Obwohl bei «Housing First» die Wohnung als erstes im Prozess stehe, funktioniere die Bezugspersonenarbeit beinahe gleich wie etwa beim betreuten Wohnen, erklärt Thomas Frommherz. Einfach in einer anderen Reihenfolge: Während man bei herkömmlichen Modellen zuerst übe und mit jeder erfolgreichen Phase die Chancen auf eine eigene Wohnung steigen, ist das eigene Zuhause am anderen Ort bedingungslos.
Erfolgreich erprobtes Modell
Dieser Ansatz findet in Schweizer Städten wie Solothurn, Winterthur, Olten, Luzern und seit neustem auch Chur immer grösseren Anklang. Schon länger bekannt und praktiziert, wird er in anderen Ländern. So wurde «Housing First» in Österreich bereits 2012 im Rahmen der Wiener Wohnungshilfe entwickelt. In dieser Zeit wurden rund 350 Personen erfolgreich betreut, wie die Studie «Housing First Guide Europe» (PDF 2.22 MB) festhält. Genutzt wurden dafür mehrheitlich Räume des sozialen Wohnungsbaus. Dessen hoher Anteil ist ein klarer Standortvorteil der österreichischen Hauptstadt. Und so sind auch die Zahlen beeindruckend: Eine Auswertung ergab eine Wohnstabilität von über 96 Prozent.
Vor grösseren Herausforderungen stehen dagegen Städte wie Zürich, wo die Leerwohnungsziffer rückläufig ist und Ende 2023 gerade einmal 0,06 Prozent betrug – das sind 144 Wohnungen. Die Mieten gehören zu den höchsten landesweit. Es verwundert also nicht, dass die Skepsis armutsbetroffener Personen in Zürich im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt mit 90 Prozent besonders hoch ist.
Zürich will Erfahrungen sammeln
Dies zeigten Ergebnisse der ersten Schweizer «Coordination nationale» im vergangenen Jahr, einer Studie mehrerer Universitäten sowie des Nationalfonds zum Ausmass der Obdachlosigkeit in den acht grössten Städten der Schweiz. Für die Untersuchung wurden betroffene Menschen ab 18 Jahren in einer quantitativen Face-to-Face-Situation befragt.
Dennoch überzeugt der Ansatz auch in Zürich, wo in einem Pilotprojekt getestet wird, wie die Prinzipien von «Housing First» in der Stadt umgesetzt werden können. Im vergangenen Jahr startete die Vorbereitungsphase, noch vor den Sommerferien begann die operative Phase. Geleitet wird das Pilotprojekt von den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB), wo es dem Geschäftsbereich Wohnen und Obdach angegliedert ist.
Was ist das Ziel des Projekts? «Wir möchten möglichst breite Erfahrungen sammeln», lautet Stefan Bänis Antwort. Der Leiter Geschäftsbereich Wohnen und Obdach im Sozialdepartement erklärt, wie das Pilotprojekt geplant ist: In einem ersten Schritt werden seit Juli Adressat:innen einer Liegenschaft, die bereits von der städtischen Wohnintegration betreut wurden, neu nach den Prinzipien von «Housing First» unterstützt. Zusätzliches Ziel ist, bis Ende Jahr obdachlose Menschen auch in Einzelwohnungen privater oder genossenschaftlicher Trägerschaften unterzubringen.
Ausbalanciertes Angebotssystem
Wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss evaluiert wird das Pilotprojekt von der ZHAW Soziale Arbeit. Martial Jossi, der diesen wissenschaftlichen Teil leitet, sagt: «Die Wohnungssuche gestaltet sich für sehr viele Menschen in der Schweiz schwierig, vor allem in den Ballungszentren. Personen mit multiplen Problemlagen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind, sind daher besonders belastet.» Gerade deshalb sei der «Housing First»-Ansatz so wichtig, betont Jossi: «Die Teilnehmenden schliessen neu einen eigenen Mietvertrag ab, dann folgt eine individuelle und selbstbestimmte Betreuung durch das zuständige ‹Housing First›-Team.»
Es zeigt sich auch an diesem Beispiel gut, wie wichtig es ist, den grundlegenden Ansatz von «Housing First» an die jeweiligen örtlichen und sozialen Situationen anzupassen. Zwar hat sich etwa auch in den USA viel getan in den letzten Jahren. Und doch unterscheidet sich das soziale Sicherungssystem stark von dem in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern. Wie ist es also möglich, diesen neuen, gänzlich anderen Ansatz von Wohnungshilfe neben dem bereits etablierten System umzusetzen?

«Hierzulande gibt es bereits viele Angebote, die bereits ähnlich wie ‹Housing First› oder nach einzelnen Prinzipien dieses Ansatzes funktionieren und damit erfolgreich sind», sagt Martial Jossi. Wichtig sei, dass man «Housing First» als ganzheitlichen neuen Ansatz in der Obdachlosenhilfe verstehe. Angebote, die sich danach ausrichten, sollten dementsprechend konzipiert und ausgestaltet werden.
Ganz konkret werden im Leitfaden «Housing First Guide Europe» die acht Grundprinzipien beschrieben: Wohnen ist ein Menschenrecht; Nutzer: innen müssen sich nicht zu einer Behandlung oder Betreuung verpflichten und sie haben Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeiten; das ganzheitliche Wohlbefinden steht im Fokus (Recovery-Orientierung); Drogen- und Alkoholkonsum sind nicht verboten, sondern man versucht in der Betreuung, den problematischen Konsum zu vermindern (Harm-Reduction); aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang; personenzentrierte Hilfeplanung; flexible Hilfen so lange wie nötig.
Angebotssystem weiterentwickeln
Doch wie sieht es mit dem generellen Bedarf für «Housing First» in der Stadt Zürich aus? «Wir verfügen bereits über ein sehr gut ausbalanciertes Angebotssystem, das wir laufend weiterentwickeln», ordnet Stefan Bäni den Ansatz im lokalen Kontext ein. Und zumindest im niederschwelligsten Angebot, der Notschlafstelle, können sie derzeit auch keine signifikante Zunahme von schwer psychisch kranken Obdachlosen feststellen.
«Dennoch», so Bäni, «leiden 96 Prozent aller erwachsenen Einzelpersonen in unseren Einrichtungen an mindestens einer psychischen Erkrankung.» Dies zeige die gemeinsame Studie des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach und der Städtischen Gesundheitsdienste, kurz WOPP-Studie, aus dem Jahr 2021. Laut dieser Untersuchung hat sich der psychische Gesundheitszustand der Klient: innen weiter verschlechtert.
In den kommenden Jahren weiterverfolgt wird der «Housing First»-Ansatz auch in Basel. «Wir bleiben hoffentlich dran», sagt Thomas Frommherz. Die Heilsarmee bewerbe sich für das fixe Mandat, in welches das Pilotprojekt bald überführt wird. Hilfreich seien ausserdem neue Bau- und Wohnprojekte sowie Kooperationen wie etwa mit der Christoph-Merian-Stiftung. Auch dort habe «Housing First» bereits einen Funken gezündet.
Dort, wo früher Kupfer verarbeitet wurde, werden seit Anfang Jahr neue Wege des Zusammenlebens, Konsumierens und Gestaltens ausprobiert: Das Labör, wie sich das Projekt nennt, versteht sich als Reallabor im Herzen von Neu-Oerlikon. Es verbindet die Themenfelder Nachhaltigkeit, Kultur und Gemeinschaft auf praktische Weise – mit Werkstätten, kulturellen Veranstaltungen, Workshops und einem geplanten Quartiercafé, das bewusst nicht «fertig» ist, sondern gemeinsam mit der Bevölkerung entwickelt werden kann.
Idee aus der Nachbarschaft
Ins Leben gerufen wurde das Projekt von fünf Personen, die sich aus dem Quartier, gemeinsamen Studienzeiten oder Projekten kennen. Drei davon wohnen sogar im selben Haus. Die Idee bestand schon länger und konkretisierte sich, als die Gruppe im Sommer 2023 von der Zwischennutzungsausschreibung für einen alten Industrieschuppen auf dem MFO-Areal erfuhren. «Wir haben die Chance gepackt, einen Verein gegründet und uns beworben», sagt Mitinitiantin Corinne Widmer. «Wir wollen mit der Bevölkerung einen lebendigen, sinnstiftenden Ort aufbauen, der den gesellschaftlichen Wandel hin zu mehr Nachhaltigkeit unterstützt.»
Die Quartierbevölkerung spielt beim Aufbau des Labörs eine zentrale Rolle. Eine breit angelegte Online-Umfrage erhebt Bedürfnisse, Interessen und Ideen. Gleichzeitig bringt sich der Verein aktiv ins Quartier ein – mit einem auffälligen Lastenvelo, Aktionen auf öffentlichen Plätzen und Kooperationen mit lokalen Vereinen und Institutionen. So werden Menschen erreicht, die nicht von sich aus den Weg ins Labör finden würden.

Ein Umbau mit Haltung
Das Gebäude selbst wird von den zwei Architekten im Team Bradley und Meng nachhaltig und zirkulär umgebaut. Viele Materialien stammen aus Abbruchhäusern, die Dämmung besteht aus Hanffasern und Lehm. «Wir bauen mit dem, was da ist – und mit dem, was unsere Zukunft braucht», erklärt Widmer. Unterstützung kommt dabei von Partnerinnen und Partnern aus der Forschung, etwa wenn neue Lehmmaterialien im Gebäude getestet werden, aber auch von Firmen, die beispielsweise einen Holzofen sponsern. Der Raum wird multifunktional und modular gestaltet, damit er an die Bedürfnisse der kommenden Jahre angepasst werden kann.
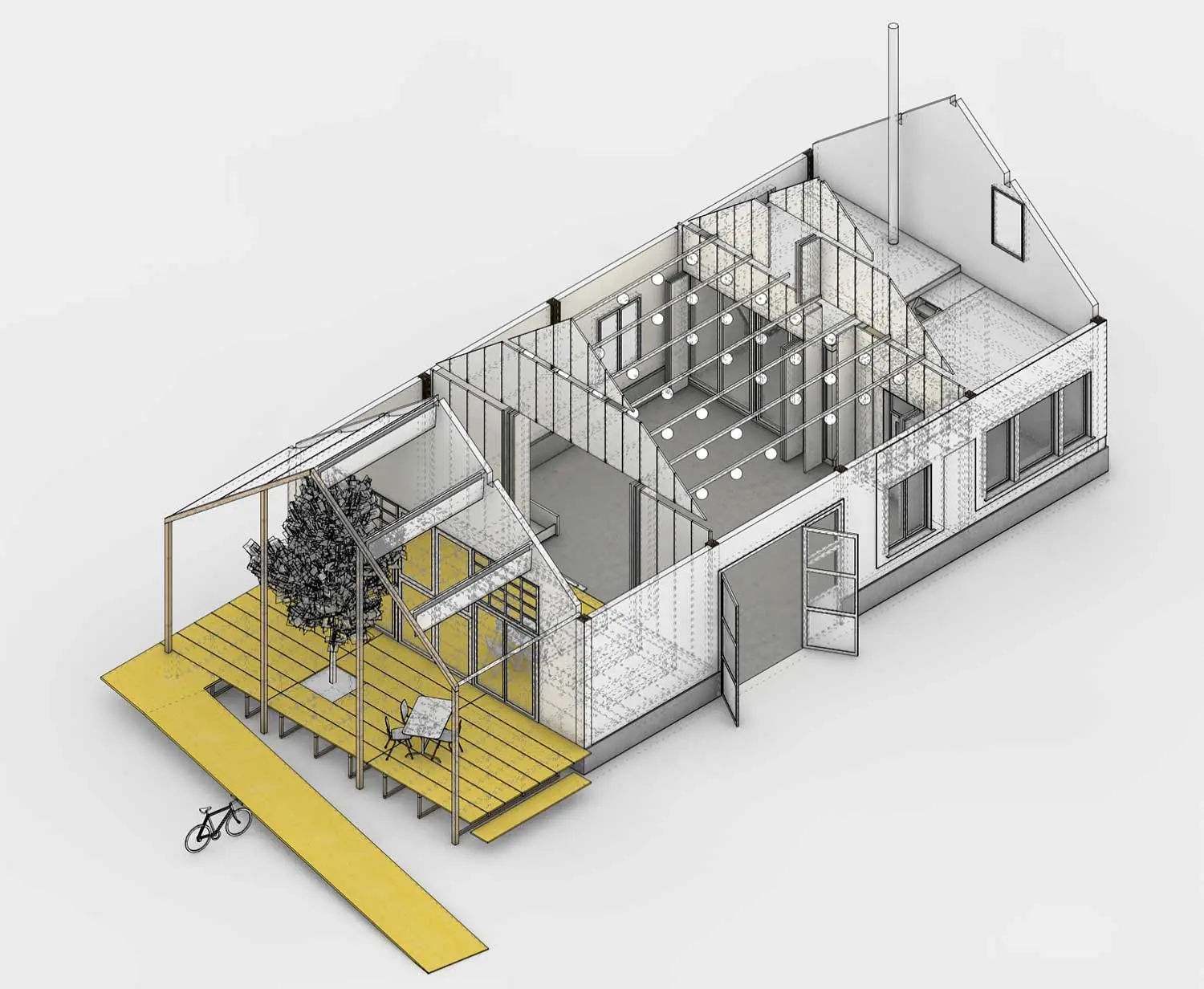
Ein CAS als Kompass
Geprägt wurde Corinne Widmers Engagement unter anderem durch den CAS Partizipative Stadt- und Gemeindeentwicklung an der ZHAW. «Im Rahmen meiner Weiterbildung habe ich anhand verschiedener Projekte erfahren, was alles entstehen kann, wenn Räume geschaffen werden, in denen Menschen gemeinsam gestalten können», sagt die studierte Gesellschaftswissenschaftlerin. Die praxisnahen Methoden aus dem CAS – von der Sozialraumanalyse über kreative Beteiligungsformate bis zur Projektumsetzung – helfen ihr bis heute.
Auch die Unterstützung durch das Social Entrepreneurship Labor (SEL) der ZHAW war für die Finanzierung des Projekts wertvoll. «Amanda Felber von der ZHAW begleitete uns mit ihrer Beratungsexpertise massgeblich bei der Einreichung des Unterstützungsantrags bei der Förderstiftung Soziale Arbeit Zürich», erinnert sich Corinne Widmer.
Vom Engagement zur Wirkung
Noch ist das Labör im Umbau, dennoch wurden bereits rund 15 Anlässe organisiert, einige davon mit über 40 Teilnehmenden. «Wenn Menschen an einem Event sagen: ‹Genau so etwas hat hier gefehlt!›, dann wissen wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind», ist Widmer überzeugt. Besonders motivierend sei auch der Moment gewesen, als das Sozialdepartement der Stadt Zürich die dreijährige Förderung als Pilotprojekt im Bereich Soziokultur gesprochen habe.

Und wie geht es weiter? Der Begegnungsraum nimmt immer mehr Form an, verschiedene Projekte sind am Entstehen und die Community wächst stetig. Am 30. August 2025 wird das grosse Eröffnungsfest stattfinden – doch «fertig» wird das Labör nie sein, betont Widmer: «Es soll sich mit den Menschen verändern, die es nutzen.»
Social Entrepreneurship Programm
Haben auch Sie eine Idee für ein soziales Projekt, wissen aber nicht, wie es anzupacken? Ihnen fehlt die Startfinanzierung, ein fachlicher Austausch oder der entscheidende Impuls? Das Social Entrepreneurship Labor der ZHAW Soziale Arbeit unterstützt Sie bei der Ausarbeitung und Umsetzung Ihres Projektvorhabens – mit persönlicher Beratung, fachlicher Begleitung und finanzieller Unterstützung.
Sie wünschen mehr Informationen? Dann kontaktieren Sie unsere Programmmanagerin Amanda Felber.
Konfliktmanagement: Was tun, wenn’s knirscht im Team?
Seit August 2022 ist unsere meistgehörte Podcast-Folge online – ein Longseller zum Thema Arbeitsplatzkonflikte. Mediatorin Sandra Nonella erklärt, dass nicht jede Auseinandersetzung gleich einen Konflikt darstellt. In ihrem Gespräch gibt sie Einblicke, wie man dem "Knirschen" im Büro auf den Grund gehen kann.
Pionierinnen der Sozialen Arbeit

Von den 2024 produzierten Episoden stiess die Folge über Frauen, die ab Ende des 19. Jahrhunderts aus Fürsorge eine Profession machten, auf das grösste Interesse. Mentona Moser (links im Bild), Jane Addams, Mary Ellen Richmond und viele mehr: Dozentin Daniela Reimer erklärt, warum Sozialarbeitende von diesen Frauen enorm viel Inspiration für sich selbst und ihr Handeln beziehen können. Die Idee für diese Episode entstand, weil Reimer eine Vorlesung für Erstsemestrige zu diesem Thema hält. Aber sie bietet auch gestandenen Praktiker:innen neue Impulse.
Fehlerkultur
Jetzt bloss keinen Fehler machen: Diesen Satz haben wir oft im Kopf. Stehen Menschenleben auf dem Spiel, ist das nicht nur verständlich, sondern unerlässlich. Aber oft haben wir einfach Angst, uns zu blamieren. Warum? Michael Herzig findet: «Fehler sind eigentlich etwas Wunderbares – weil wir aus ihnen lernen können.» Im Gespräch erklärt der Organisationsberater und ZHAW-Dozent, warum der grösste Fehler ist, keine Fehler machen zu wollen. Gerade in der Sozialen Arbeit.
Mobbing und Schule

Was sollen Eltern, Lehrpersonen oder Schulsozialarbeitende tun, wenn ein Kind gemobbt wird? Warum braucht es unbedingt eine gute Schulhauskultur? Diese Fragen sind der Ausgangspunkt der zwei Podcast-Folgen «Mobbing und Schule». Denn das Phänomen ist trotz vieler Kampagnen immer noch stark verbreitet in der Schweiz. Claudia Bernasconi ist Dozentin und Schulsozialarbeit-Expertin. Anhand von Beispielen aus ihrer Praxis und ihrem Unterricht zeigt sie, wie man aus dem Gefühl von Hilflosigkeit ins Tun kommen kann, um die Situation zu verändern.
Professionalität, die
Aus der Magazin-Kolumne «Sozipedia» wurde im vergangenen Herbst auch ein Podacst-Format: In kurzen Gesprächen – meist weniger als 10 Minuten – sezieren Co-Bachelorstudienleiter Martin Biebricher und Menno Labruyère Fachbegriffe der Sozialen Arbeit, die «auf Abwege» gekommen sind. Gemeint sind typische, meist inflationär verwendete Begriffe. Eine Kolumne wider die Worthülsen.
Podcast «sozial»
Der Podcast «sozial» ist auf allen gängigen Podcast-Playern verfügbar.


Video-Aufzeichnung
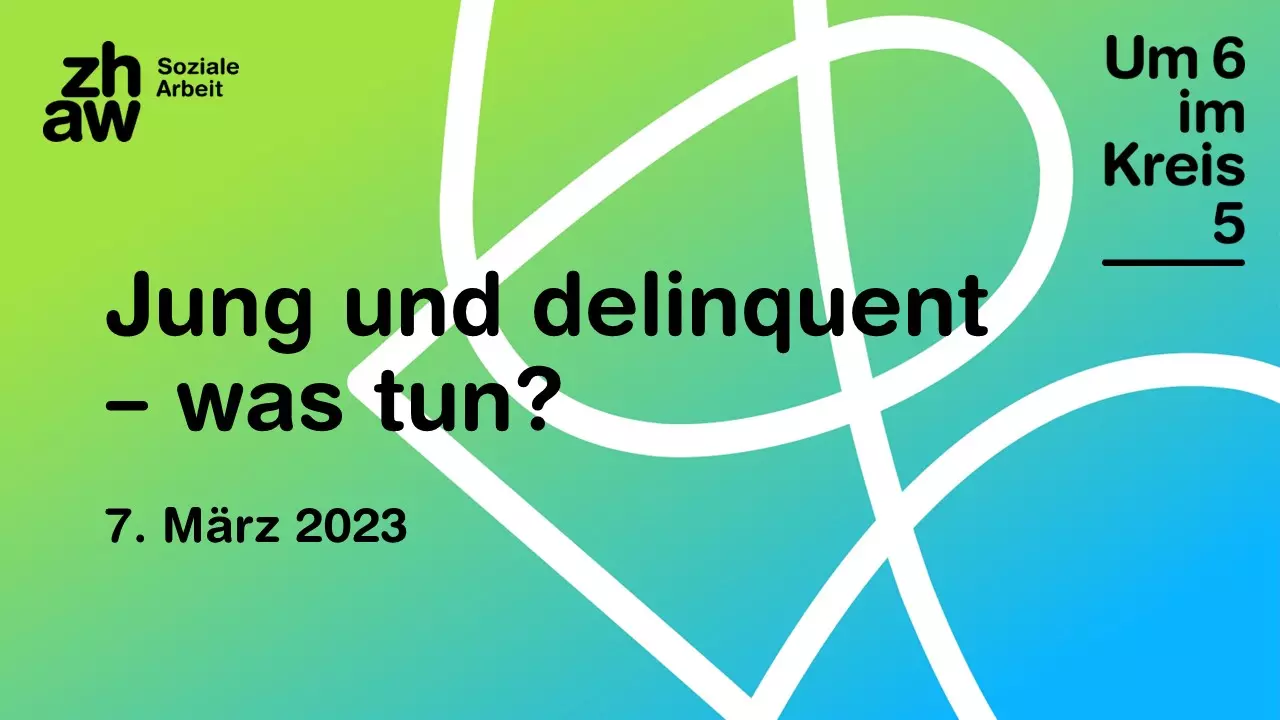

«Wichtiger als eine Fachkarriere sind Weiterbildungen, damit Mitarbeitende nicht ausbrennen.»
Regula Enderlin ist promovierte Sozialpsychologin und stellvertretende Geschäftsführerin der Stiftung Zürcher Kinder und Jugendheime.
Wohnung schafft Basis
In dem Sinn stellt bei «Housing First» das Wohnen vielmehr einen Ausgangspunkt dar als ein Ziel. Als Erstes wird den Adressat:innen eine eigene Wohnung zur Verfügung gestellt, dann erst werden individuelle und bedarfsorientierte Unterstützungsmassnahmen mit ihnen vereinbart: von der Strasse direkt in eine eigene Wohnung, ohne Vorbedingung.
In der Stadt Basel haben seit Mitte 2020 bereits über zwanzig Obdachlose ein eigenes Zuhause bekommen. Thomas Frommherz von der Heilsarmee leitet das Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit der Sozialhilfe und im Auftrag des Kantons. «In fast allen Fällen hat es sich bewahrheitet, dass eine sichere Wohnung den Boden schafft, um überhaupt weiterzukommen», sagt Frommherz.
Die Kolumne als Podcast
Wollen Sie mehr hören über Fachbegriffe der Sozialen Arbeit hören, deren Bedeutung im Laufe der Jahre durch häufigen Gebrauch vielleicht verwässert wurde?
Martin Biebricher, Co-Studiengangleiter Bachelor, spricht mit Menno Labruyère, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Digital Campus und ausgebildeter Sozialarbeiter, im gleichnamigen Podcast regelmässig über Fachbegriffe auf Abwegen.
«Sozipedia» ist eine Rubrik des ZHAW-Podcasts «sozial» und auf allen gängigen Playern verfügbar. Jetzt abonnieren – keine Episode verpassen!
Podcasts «Sozipedia» und «sozial»
Begegnung mit einer «Kämpferin»
In Tansania gibt es eine starke kulturelle Tradition der gegenseitigen Unterstützung und Solidarität: Man hilft einander und erfüllt die Bedürfnisse der Gemeinschaft. Dementsprechend steht die Community auch im Mittelpunkt der Sozialen Arbeit. Ein wichtiger Fokus liegt auf der Bildung und dem Empowerment benachteiligter Gruppen, insbesondere von Frauen und Kindern.
Ich denke da an Neema. Wir lernten uns kennen, als sie 16 Jahre alt und bereits alleinerziehende Mutter einer kleinen Tochter war. Mit 15 war sie ungewollt schwanger geworden. Die talentierte Schülerin mit grossen Zukunftsträumen verliess vorzeitig die Schule. Neema ist keine Ausnahme: Viele tansanische Mädchen und junge Frauen werden aufgrund unzureichender Aufklärung und eines begrenzten Zugangs zu Verhütungsmitteln schwanger. Oft führt dies zu Schulabbrüchen und mündet in einen Zyklus von Armut und Abhängigkeit.
Aber Neema war auch eine Kämpferin. Trotz schwieriger Umstände fand sie den Mut, unterstützt von Sozialarbeitenden, ihren Schulabschluss nachzuholen. Durch die Bekanntschaft mit Neema gewann ich ein tieferes Verständnis für die komplexen sozialen und strukturellen Probleme junger Menschen in Tansania. Mitzuerleben, wie die junge Frau ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft nicht verlor, war für mich eine bewegende Erfahrung. Es ermutigte mich, mich intensiv für die Belange junger Menschen einzusetzen und ihre Stimmen in den Mittelpunkt meiner zukünftigen Arbeit als Sozialarbeiterin zu stellen.
Druck zur raschen Eingliederung
Auf der institutionellen Ebene bewegt sich Soziale Arbeit heute in den Rahmenbedingungen eines aktivierenden Sozialstaates. Dazu gehören reduzierte Sozialleistungen für Armutsbetroffene und Erwerbslose, verschärfte Anspruchsvoraussetzungen und Sanktionsmöglichkeiten sowie verkürzte Bezugszeiten.
Die individuelle Lebenssituation, die subjektiven Erfahrungsräume und persönlichen Lebensentwürfe fallen dem Druck zur raschen Eingliederung vermehrt zum Opfer. Während oftmals nur eine prekäre berufliche Integration erreicht wird, gibt es zugleich eine Gruppe von Langzeiterwerbslosen, die als nicht mehr arbeitsmarktfähig gelten. Diese Personen, die teilweise in Sozialfirmen oder Beschäftigungsprogrammen arbeiten, erleben eine gravierende soziale Abwertung.
«Da müssen wir immer machen, was wir wollen»: So berichtete mir der Kindermund einmal leicht verärgert-gelangweilt von Erlebnissen aus einem Projekt zur Partizipationsförderung in Kitas. Und traf damit bei mir einen Nerv. Der Begriff Partizipation hat in den letzten 20 Jahren im Jargon der Sozialen Arbeit massiv an Konjunktur gewonnen. Keine Angebotskonzeption, kein Förderantrag und kein Schlussbericht kommen mehr ohne den Verweis auf die (vermeintliche) Partizipation der Adressatinnen und Adressaten aus. Die inflationäre Verwendung des Begriffs weckt allerdings meine Skepsis. Was meint Partizipation eigentlich? Und, noch viel wichtiger: Lösen wir als Fachpersonen der Sozialen Arbeit den damit verbundenen Anspruch tatsächlich ein?
Das Wort Partizipation leitet sich vom lateinischen partem capere ab, was mit den (oder einen) Teil ergreifen/sich nehmen oder erhalten/bekommen übersetzt werden kann. Damit einher gehen also immer auch eine aktive und eine passive Konnotation. Menschen werden passiv beteiligt, nehmen aktiv an etwas teil, sie haben Teil oder nehmen sich ihren Teil. Noch mehr Brisanz steckt in der Verbform von Partizipation: «Partizipieren» beschreibt der Duden als «von etwas, was ein anderer hat, etwas abbekommen». Es geht also neben dem Teilen von Entscheidungsgewalt immer auch um das Teilen von sozialen, kulturellen und ökonomischen Ressourcen.
Partizipation meint demnach viel mehr als das blosse Abholen von Meinungen oder Ideen. Aus der Forschung wissen wir zudem, dass sich dabei oft diejenigen durchsetzen, die ohnehin schon über mehr Kompetenzen, Zeit und Beziehungen verfügen als andere. So gesehen kann falsch verstandene Partizipation auch zu Exklusion führen. Nimmt man vor diesem Hintergrund den Partizipationsbegriff ernst, ist damit ein besonderer Anspruch verbunden.
Der Erziehungswissenschaftler Hans Thiersch schrieb: «Mitbestimmung ist ein konstitutives Moment Sozialer Arbeit; sie allein reicht aber nicht, solange sie nicht einhergeht mit der Institutionalisierung von Einspruchs- und Beschwerderechten, wie sie dem Status des Bürgers in einer Demokratie entsprechen.» Anders gesagt: Es geht darum, jenen Menschen, die es mit der Sozialen Arbeit zu tun bekommen, die Entscheidungsgewalt über ihren Alltag zurückzugeben – auch dann, wenn wir mit diesen Entscheidungen nicht einverstanden sind.
«Klappern gehört zum Handwerk», sagt ein Sprichwort. Wer mit einem ärztlichen Bericht, einer juristischen Argumentation oder einer IT-Bedienungsanleitung konfrontiert ist, mag leidvoll ergänzen: «Fachsprache gehört zur Profession.» Das ist bei der Sozialen Arbeit nicht anders. Manche Fachbegriffe erleichtern die Kommunikation, weil sie Klarheit schaffen. Andere werden unterschiedlich verstanden. Und dann gibt es die dritte Gruppe: den Jargon. Also aus lauter Gewohnheit verwendete Fachbegriffe. Mitunter stehen sie im Widerspruch zu dem, was man aussagen möchte. Klientel ist für mich ein solcher Fachbegriff auf Abwegen.
Als junger Student lernte ich vor knapp 30 Jahren: In der Sozialen Arbeit haben wir es mit Klientinnen und Klienten zu tun. Das hat mir imponiert. Es klang nach Anwaltschaftlichkeit, nach bedingungslosem Einsatz für Gerechtigkeit. Nach Berufen mit hohem Renommee, wie Rechtsanwältin oder Steuerberater. Bald darauf erfuhr ich, wie der Begriff in die Soziale Arbeit kam: Die in der Nachkriegszeit aus den USA nach Europa (re)importierten psychoanalytisch geprägten, liberalen, pragmatischen Methodenansätze des Social Caseworks benutzen das englische client. Damit versuchten sie, das demokratische Bild von Menschen zu transportieren, die als entscheidungsfähige Subjekte die Soziale Arbeit aus eigenem Antrieb beauftragen, ihnen zu helfen.
Bis heute irritiert mich aber der zur Beschreibung einer Gesamtheit von Klientinnen und Klienten verwendete Begriff Klientel. Im alten Rom waren cliens die halbfreien Abhängigen von Patrizierfamilien: Dienstboten, Mägde, Knechte. Im Deutschen vergleichbar mit dem auf einem Gutshof verdingten Gesinde. Der Duden verweist auch auf das lateinische clientela und übersetzt dies mit «die Gesamtheit der Hörigen».
Hörige, Verdingte, Gesinde – niemand käme heute ernsthaft auf die Idee, Menschen, die Soziale Arbeit in Anspruch nehmen oder von der Sozialen Arbeit in Anspruch genommen werden, so zu bezeichnen. Und doch hört man den Begriff häufig. Dabei beschreibt «Klientel» nicht etwa entscheidungsfähige Subjekte, sondern macht Menschen sprachlich zur Verfügungsmasse einer absolut herrschenden Macht. Kritischen Sozialarbeitenden, die es mit der Ermächtigung, dem empowerment ihrer Adressatinnen und Adressaten ernst meinen, dürfte dieser Umstand zu denken geben.
Wieso zeigt dann der Fachkräftemangel-Index des Personaldienstleisters Adecco einen Fachkräfteüberschuss in der Soziale Arbeit an?
Lucrezia Bernetta: Der Index gibt ein falsches Bild wieder, weil die Berufsgruppe, unter welche Sozialarbeitende fallen, extrem heterogen zusammengewürfelt ist. Der Index zählt auch Erwerbstätige aus dem Rechtsbereich, den Medien, der bildenden Künste und so weiter dazu.
Daniela Wirz: Aufgrund der Savoirsocial-Studie ging man davon aus, dass der steigende Bedarf an Fachkräften durch Nachwuchs aus den Hochschulen und aus Zuwanderung gedeckt werden könnte. In der Tat gibt es heute mehr Nachwuchs. Beim Zusammenschluss der ZHAW im Jahr 2008 zählte das Departement Soziale Arbeit 589 Studierende, heute sind 968 immatrikuliert. Und die Zahl der Absolvent:innen ist von 99 auf über 200 pro Studienjahr gestiegen.
«Sozipedia» - neu auch als Podcast
Ist uns bewusst, was wir sagen, wenn wir das Wort Klientel verwenden? Oder Partizipation? Oder Diskriminierung? Oftmals nicht, findet ZHAW-Dozent und -Forscher Martin Biebricher. Der Leiter des Bachelorstudiengangs geht in der Kolumne «Sozipedia» Fachwörtern, die oftmals unbedacht verwendet werden, auf den Grund. Die Kolumne erscheint im Magazin «sozial» und neu auch als Podcast – hören Sie rein.

Abwertende Stereotypen
Zudem schreibt der aktivierende Sozialstaat die Verantwortung für nicht gelingende berufliche Integration den Individuen zu. Diese Individualisierung von sozialen Problemlagen übersetzt sich in der Sozialen Arbeit durch einen Fokus auf Einzelfallhilfe und Therapeutisierung sowie den Rückzug der Gemeinwesenorientierung.
Zugleich lässt sich eine Einteilung in aktivierbare sowie nicht aktivierbare (oder -willige) Adressat:innen beobachten. Die traditionelle Unterteilung in unverschuldete und selbst verschuldete Arme verbindet sich mit einem stigmatisierenden Urteil über jene Personen, die aufgrund fehlender Bildung oder charakterlicher Eigenschaften auf dem Arbeitsmarkt scheinbar nicht (mehr) gebraucht werden können.
Diese Veränderungen auf institutioneller Ebene gehen mit der Diffusion von abwertenden Begriffen, Bildern und Stereotypen auf der kulturellen Ebene einher. Gewisse mediale und politische Diskurse etablieren ein klassistisches Sprechen über armutsbetroffene und erwerbslose Menschen.
Heimweh und grüssende Elefanten
So bereichernd und aufregend ein Praktikum im Ausland auch ist, lässt sich eine Erfahrung nicht wegreden, die viele Reisende machen: die Einsamkeit. Familie und Freund:innen sind fern, und wegen der Sprache bleibt man in vielen Situationen Zaungast. In Tansania wird hauptsächlich Swahili gesprochen – ich verstand kein Wort. Selbst auf dem Markt Obst zu kaufen, konnte in ein aufwendiges Prozedere münden. Gerade wenn ich abends im Bett lag, sehnte ich mich oft nach vertrauten Gesichtern und vertrauten Gesprächen.
Dem gegenüber stand die umwerfende Natur. Der Höhepunkt in dieser Hinsicht war zweifellos die Morgenfahrt durch den Ngorongoro-Krater, der sich am Rande der Serengeti befindet. Als wir in den Krater fuhren, lag über der Landschaft eine unglaubliche Ruhe, während die Elefanten uns zu grüssen schienen und die ersten Sonnenstrahlen langsam den Horizont erhellten.
Downloads
Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:
Präsentation «Jung und delinquent – was tun?» (PDF 1.55 MB)
Den erwähnten Studienbericht können Sie ebenfalls als PDF herunterladen:
Jugenddelinquenz in der Schweiz: Bericht zu den zentralen Ergebnissen der 4. «International Self-Report Delin-quency» Studie (ISRD4)

«Mitarbeitende sollten die Möglichkeit haben, das dritte Mandat wahrzunehmen .»
Daniela Wirz ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der ZHAW Soziale Arbeit und leitet die Fachstelle Kooperationen und Vernetzung.
Die meisten seiner Adressat:innen waren zuvor langjährig obdachlos. «Nun sind wir ihr Rückhalt, um wieder Fuss fassen zu können », weiss Frommherz. In der Praxis bedeutet das oft zuerst einmal Beistand bei der Bewältigung der Flut an Briefen, Bussbescheiden und Mahnungen, die in der Regel eintreffen, wenn es wieder eine feste Adresse gibt. Aber natürlich auch bei Krisen, Rückfällen oder finanziellen Engpässen.
Obwohl bei «Housing First» die Wohnung als erstes im Prozess stehe, funktioniere die Bezugspersonenarbeit beinahe gleich wie etwa beim betreuten Wohnen, erklärt Thomas Frommherz. Einfach in einer anderen Reihenfolge: Während man bei herkömmlichen Modellen zuerst übe und mit jeder erfolgreichen Phase die Chancen auf eine eigene Wohnung steigen, ist das eigene Zuhause am anderen Ort bedingungslos.
Gutbürgerliche Norm
Die Unterstellung von Faulheit und Arbeitsunwilligkeit sowie die Skandalisierung von Sozialbetrug durch Empfänger:innen von Sozialleistungen sind nur die Spitze des Eisbergs. Mit diesem medialen Diskurs gehen auch klassistische Bewertungen einher, die Menschen, ihren Geschmack und ihre Vorlieben sowie ihre Lebensweisen als von den gutbürgerlichen Normen der Mittelschicht abweichend stigmatisieren. Armutsbetroffene Menschen werden häufig als unqualifiziert, zu wenig flexibel oder einem ungesunden Lebensstil folgend beschrieben.
Auch in der Politik zirkulieren diese stereotypen Darstellungen, denen zufolge die Lebensweisen und (falschen) Lebensentscheidungen dieser Menschen verantwortlich für ihre prekäre Situation wären. Der Soziologe Stefan Wellgraf bezeichnet diese Verbindung eines niedrigen Status mit sozialer Geringschätzung in seinem Buch «Hauptschüler» (2012) als «gesellschaftliche Produktion von Verachtung».
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Der Nachwuchs ist also da. Aber warum bleibt er nicht im Berufsfeld?
Lucrezia Bernetta: Die Einarbeitungszeit ist ein grosses Thema. Sie ist zu kurz, es kommt zur Überforderung. Der Unterschied zwischen dem, wie Soziale Arbeit im Studium gelernt wird, und dem, wie sie in der Praxis gelebt wird, ist teilweise gross.
Regula Enderlin: Auch ich höre, dass junge Sozialarbeitende zu wenig auf die Arbeit mit unseren sehr herausfordernden Kindern und Jugendlichen vorbereitet sind. Um den Einstieg in dieses schwierige Feld zu begleiten, läuft derzeit ein Projekt, das vom zuständigen Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich finanziell gefördert wird. Hier werden Berufseinsteigende beim Start im stationären Kontext mit einem Ausbildungsprogramm in Form eines Studienhandbuchs unterstützt. Als leistungserbringende Stiftung begrüssen wir diese Anstrengungen sehr. Man darf nicht warten, bis Berufseinsteigende verzweifeln.
Liegt die Überforderung am jungen Alter oder an der Ausbildung?
Daniela Wirz: Ganz so einfach lässt sich die Situation nicht erklären. In der 2021 zuletzt durchgeführten Absolvent:innen-Studie des Bundesamts für Statistik gaben die Befragten an, sich durch den Bachelorabschluss an der ZHAW grundsätzlich gut auf den Berufseinstieg vorbereitet zu fühlen. Dennoch kam an den zwei Runden Tischen zum Fachkräftemangel im Sozialbereich, die das Departement Soziale Arbeit dieses Jahr mit Vertreter:innen der Zürcher Sozialarbeitspraxis und der öffentlichen Verwaltung durchführte, das Phänomen des Praxisschocks von Berufseinsteigenden auf. Als Fachhochschule wollen wir neben einer fundierten theoretischen Ausbildung natürlich auch dazu beitragen, diesen Praxisschock durch die Vermittlung von realistischen Bildern über die Praxis und die Herausforderungen und Besonderheiten einzelner Handlungsfelder abzufedern.
Der Praxisanteil eines Bachelorstudiums an der ZHAW ist mit 1500 Stunden schon ziemlich hoch.
Daniela Wirz: Ja, und die Praxisausbildung ist eine wichtige, aber nicht die einzige Möglichkeit, Realitätsbezug herzustellen. Ab Herbst bieten wir beispielsweise neu die Möglichkeit an, dass Bachelorstudierende sich ein zivilgesellschaftliches Engagement oder die Mitarbeit in einem Projekt mit Bezug zu Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit in Form von ECTS-Credits anrechnen lassen können. Damit wollen wir ein zusätzliches Fenster zur Praxis öffnen.
Was sind weitere Gründe für die Abwanderung aus dem Berufsfeld?
Lucrezia Bernetta: Oft ist es eine Mischung aus unbefriedigenden Arbeitsbedingungen und persönlichen Motiven. Am häufigsten genannt werden der Wunsch nach beruflicher Entwicklung, Mangel an gesellschaftlicher Anerkennung, fehlende Unterstützung durch Vorgesetzte, psychische Belastung im Job, zu tiefer Lohn. Was den stationären Bereich angeht, so hören wir beim Fachverband AvenirSocial immer wieder, dass Arbeitnehmende trotz Teilzeitanstellung bis zu sechs oder sogar sieben Tage am Stück arbeiten müssen; das ist belastend und nicht familienfreundlich. Und manchmal wird Pikettdienst nicht entlöhnt.
Erfolgreich erprobtes Modell
Dieser Ansatz findet in Schweizer Städten wie Solothurn, Winterthur, Olten, Luzern und seit neustem auch Chur immer grösseren Anklang. Schon länger bekannt und praktiziert, wird er in anderen Ländern. So wurde «Housing First» in Österreich bereits 2012 im Rahmen der Wiener Wohnungshilfe entwickelt. In dieser Zeit wurden rund 350 Personen erfolgreich betreut, wie die Studie «Housing First Guide Europe» (PDF 2.22 MB) festhält. Genutzt wurden dafür mehrheitlich Räume des sozialen Wohnungsbaus. Dessen hoher Anteil ist ein klarer Standortvorteil der österreichischen Hauptstadt. Und so sind auch die Zahlen beeindruckend: Eine Auswertung ergab eine Wohnstabilität von über 96 Prozent.
Vor grösseren Herausforderungen stehen dagegen Städte wie Zürich, wo die Leerwohnungsziffer rückläufig ist und Ende 2023 gerade einmal 0,06 Prozent betrug – das sind 144 Wohnungen. Die Mieten gehören zu den höchsten landesweit. Es verwundert also nicht, dass die Skepsis armutsbetroffener Personen in Zürich im Zusammenhang mit dem Wohnungsmarkt mit 90 Prozent besonders hoch ist.
Moralische Bewertung in der Praxis
Der aktivierende Sozialstaat bleibt auch auf individueller Ebene in der Praxis der Sozialen Arbeit nicht wirkungslos. So finden sich Spuren des Diskurses über Armut und Arbeitslosigkeit in Einstellungen und Sichtweisen von Sozialarbeitenden. Sie sind nicht davor geschützt, abwertende Begriffe und Bilder zu verinnerlichen, die sich auf institutionalisierter und auf kultureller Ebene verfestigt haben.
Selbst wohlwollend gemeinte Worte oder Angebote können auf unreflektierten Annahmen zu Hilfsbedürftigkeit oder mangelnden Ressourcen beruhen, die abwertenden Charakter haben und einer problematischen Klientelisierung Vorschub leisten. Solche Einstellungen können sowohl in der Kommunikation mit den sowie über die Adressat:innen hörbar werden. Zusätzlich laufen Sozialarbeitende Gefahr, die durch einen aktivierenden Sozialstaat vorgegebenen Kategorisierungen der Adressat: innen in die (nicht) Aktivierbaren, die Unwilligen oder die Chancenlosen zu verinnerlichen. Diese Einteilung geht in der Praxis mitunter einher mit einer moralischen Bewertung darüber, wer Hilfe verdient und wer nicht.

« Immer wieder wird bemängelt, dass in vielen Organisationen alle in etwa denselben Job zum selben Lohn machen, dies unabhängig vom Abschluss, sei das nun Fachhochschule oder Höhere Fachschule, Bachelor oder Master.»
Lucrezia Bernetta ist in der Sozialpädagogischen Familienarbeit tätig. Sie gehört zur Regionalleitung Zürich/Schaffhausen des Berufsverbands AvenirSocial und vertritt die SP in der Sozialbehörde der Stadt Zürich.
Zürich will Erfahrungen sammeln
Dies zeigten Ergebnisse der ersten Schweizer «Coordination nationale» im vergangenen Jahr, einer Studie mehrerer Universitäten sowie des Nationalfonds zum Ausmass der Obdachlosigkeit in den acht grössten Städten der Schweiz. Für die Untersuchung wurden betroffene Menschen ab 18 Jahren in einer quantitativen Face-to-Face-Situation befragt.
Dennoch überzeugt der Ansatz auch in Zürich, wo in einem Pilotprojekt getestet wird, wie die Prinzipien von «Housing First» in der Stadt umgesetzt werden können. Im vergangenen Jahr startete die Vorbereitungsphase, noch vor den Sommerferien begann die operative Phase. Geleitet wird das Pilotprojekt von den Sozialen Einrichtungen und Betrieben (SEB), wo es dem Geschäftsbereich Wohnen und Obdach angegliedert ist.
Was ist das Ziel des Projekts? «Wir möchten möglichst breite Erfahrungen sammeln», lautet Stefan Bänis Antwort. Der Leiter Geschäftsbereich Wohnen und Obdach im Sozialdepartement erklärt, wie das Pilotprojekt geplant ist: In einem ersten Schritt werden seit Juli Adressat:innen einer Liegenschaft, die bereits von der städtischen Wohnintegration betreut wurden, neu nach den Prinzipien von «Housing First» unterstützt. Zusätzliches Ziel ist, bis Ende Jahr obdachlose Menschen auch in Einzelwohnungen privater oder genossenschaftlicher Trägerschaften unterzubringen.
Mehr Bewusstsein
Wo aber könnte eine klassismuskritische Soziale Arbeit ansetzen? Zum einen sollte die Soziale Arbeit wieder politischer werden. Fundierte Klassenanalysen und das Wissen über strukturelle Ursachen sozialer Ungleichheiten müssen im Studium der Sozialen Arbeit vermittelt werden. Es braucht eine kritische Auseinandersetzung mit der Terminologie des aktivierenden Sozialstaates und den vorherrschenden Klassifikationen des Sozialwesens sowie ein Bewusstsein dafür, dass auch Methoden und Theorien der Sozialen Arbeit klassistischen Trends unterliegen können.
Auf individueller Ebene sollten sich Fachkräfte weiterbilden und mit ihren eigenen Verstrickungen in klassistische Strukturen auseinandersetzen. Dazu gehört auch, sich der eigenen Klassenposition bewusst zu werden und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, was der Klassenunterschied zwischen Fachpersonen und Adressat:innen für die Beziehungsarbeit und die Herstellung von Verständnis und Vertrauen bedeutet. Häufig sind etwa Bewertungen darüber, was Sozialarbeitende für die Adressat:innen als erstrebenswert erachten (z.B. betreffend Erwerbstätigkeit, Bildung, Erziehung und Freizeitaktivitäten) in unreflektierte und klassenspezifische Bewertungsstrukturen eingelassen. Um sich dessen bewusst zu werden, braucht es institutionalisierte Reflexions- und Diskussionsräume.
Regula Enderlin: Ich finde den Ansatz vielversprechend, neue Arbeitszeitmodelle einzuführen. Bei Schicht ist vor allem der Wechsel problematisch. Wie im Spital könnten auch stationäre sozialpädagogische Einrichtungen Jobprofile erstellen, bei denen man nur Nachtschicht macht – oder eben keine. Wir prüfen derzeit ein solches Projekt. Eine allgemeine Erhöhung des Lohnniveaus scheint mir nicht zwingend die Lösung für den Fachkräftemangel zu sein. Er betrifft schliesslich auch Branchen, in denen die Löhne höher sind. Aber was die Abgeltung von Nacht- und Wochenendschichten angeht, muss etwas getan werden. Sie ist zu tief.
Wie im medizinischen Bereich ächzen auch im Sozialwesen viele unter der Dokumentationspflicht.
Regula Enderlin: Vieles, was nicht im direkten Klient:innen-Kontakt stattfindet, gilt als Administration. Aber das muss man differenzierter anschauen. Teamsitzungen sind unabdingbar, ebenso die Falldokumentation für eine saubere Übergabe innerhalb des Betreuungsteams und die Förderplanung als Reflexionsraum. Im Betrieb, den ich früher leitete, investierte ich viel, damit für das Erstellen der Berichte möglichst wenig Zeit beansprucht wurde. Sie purzelten mehr oder weniger aus den Standortbestimmungen und Förderplandokumenten heraus.
Lucrezia Bernetta: Das ist leider vielerorts nicht der Fall, oft dauert es eine Stunde oder länger pro Bericht.
Regula Enderlin: Wenn man mit der Förderplanung arbeitet und gut dokumentiert, an welchen Zielen wie gearbeitet wird und ob die Ziele erreicht wurden, dann sind die Berichte meines Erachtens schon fast geschrieben. Aber wenn ich höre, dass mit dem Schreiben von Berichten eine Wertschätzung gegenüber den Klient:innen ausgedrückt werden soll, läuft etwas schief. Berichte dürfen nicht zum Selbstzweck geschrieben werden. Die Wertschätzung muss viel früher mitgedacht werden, nämlich bei der Förderplanung und bei den Standortbestimmungen.
Und was müsste getan werden, damit der Wunsch nach beruflicher Entwicklung erfüllt werden kann?
Lucrezia Bernetta: Immer wieder wird bemängelt, dass in vielen Organisationen alle in etwa denselben Job zum selben Lohn machen, dies unabhängig vom Abschluss, sei das nun Fachhochschule oder Höhere Fachschule, Bachelor oder Master.
Daniela Wirz: Hier könnte man nochmals den Vergleich mit dem Gesundheitsbereich wagen und einen Skill-Grade-Mix implementieren. Man setzt dann die Teams in Bezug auf Fähigkeiten sowie Berufs- und Lebenserfahrung zusammen. Mit unterschiedlichen Verantwortungs- und Tätigkeitsbereichen ist auch eine unterschiedliche Entlöhnung naheliegend – und die Chance, sich zu entwickeln, allenfalls Karriere zu machen.
Regula Enderlin: Ich bezweifle, dass die Fachkarriere das Problem des Fachkräftemangels löst.
Warum?
Regula Enderlin: Weil sie die Zufriedenheit der Hochqualifizierten nicht steigert. Die Arbeit selbst wird dadurch nicht attraktiver, man hat nicht auf einmal mehr Zeit für die Klient:innen. Das sieht man in den Spitälern, wo das gemacht wird. Es ist viel wichtiger, dass die Mitarbeitenden sich durch Weiterbildungen für die immer anspruchsvoller werdenden Aufgaben besser qualifizieren können, damit sie gesund bleiben und nicht ausbrennen und kündigen. Ihre Gesundheit ist ein hohes Gut.
Ist wegen dieser Art der Belastung die Fluktuation im stationären Bereich besonders hoch?
Regula Enderlin: Wir haben keine statistische Gewissheit, dass dem wirklich so ist. Sicher ist aber, dass die Belastung steigt, etwa wegen der zunehmend komplexeren Biografien von Kindern und Jugendlichen durch Traumatisierungen und Bindungsstörungen. Wir stellen auch mehr grenzverletzendes Verhalten fest. Immer weniger Fachpersonen wollen sich das antun. Andere gehen, weil sie wegen Unterbesetzung überlastet oder unbefriedigt sind, da sie zu wenig Zeit für die Beziehungsarbeit mit den Klient:innen haben. In einer solchen Situation müssen Organisationen die harte Entscheidung fällen, ob sie ihre Mitarbeitenden schützen und behalten wollen – oder die Zahl der angebotenen Plätze reduzieren, dies mit der Folge, dass Kinder und Jugendliche auf der Strecke bleiben.
Was kann man dagegen tun?
Regula Enderlin: Abgesehen von neuen Arbeitszeitmodellen und Investitionen in die Weiterbildungen braucht es genügend Fallsupervisionen und Teamintervisionen. Seit man über den Fachkräftemangel spricht, hat sich hier etwas in Bewegung gesetzt. Das finde ich positiv.
Lucrezia Bernetta: AvenirSocial hat vor Kurzem Best-Practice-Beispiele gesammelt, wie man die Arbeitsbedingungen verbessern und die Zufriedenheit steigern könnte. Es handelt sich um Massnahmen, die keine grossen politischen Veränderungen voraussetzen, sondern von Führungspersonen relativ schnell umgesetzt werden können. Zum Beispiel, berufspolitisches Engagement zu ermöglichen oder Teamzeit so zu gestalten, dass Mitarbeitende ohne Führungsfunktion Verantwortung übernehmen können.
Regula Enderlin: Berufspolitisches Engagement und Lobby-
arbeit sind wichtig. Denn der Fachkräftemangel ist nicht einfach ein Problem der Sozialen Arbeit, sondern der gesamten Gesellschaft.
Daniela Wirz: Als Expertin im Zulassungsverfahren für das Bachelorstudium höre ich in jüngster Zeit vermehrt, dass das Mitgestalten und das Weiterentwickeln von Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit auch Teil der Motivation sind. Dieses dritte Mandat, also der Bezug auf die eigene Fachlichkeit als Profession, ist eine wertvolle und wichtige Voraussetzung unter anderem für politisches Engagement. Organisationen sollten es Mitarbeitenden ermöglichen oder sie dabei fördern, das dritte Mandat wahrzunehmen.
Lucrezia Bernetta: In vielen Organisationen und Institutionen kommen die Führungspersonen nicht aus der Sozialen Arbeit, weshalb sie das Triplemandat oftmals nicht auf dem Radar haben. Es ist deshalb wichtig, dass in Leitungspositionen auch Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit sind.
Regula Enderlin: In der Sozialraumorientierung geht es darum, die Angebote entlang dem Willen der Klient:innen – im Sinne des inneren Antriebs – zu machen. In der Praxis stelle ich aber fest, dass Fachleute immer noch häufig davon ausgehen, dass sie wissen, was als nächster Schritt angesagt ist. Dass man das reflektiert und aus dieser Haltung herauskommt, das wäre für mich wichtig im Triplemandat. Nicht nur berufspolitisches Engagement, sondern auch eine kritische Auseinandersetzung damit, was Soziale Arbeit in der Gesellschaft macht. Diese Reflexionsprozesse müssen in den Institutionen passieren, angestossen oder zumindest unterstützt von Führungspersonen.
Daniela Wirz: Ich finde beide Aussagen wichtig und richtig. Und sie unterstreichen die Relevanz und die Sinnhaftigkeit eines konsekutiven Masters in Sozialer Arbeit. In unserem Fall qualifiziert er die Absolvent:innen je nach gewählter Profilrichtung genau für die kritische Reflexion und die Bearbeitung komplexer Fragestellungen, dies sowohl für Personen mit als auch für Personen ohne Führungs- oder Fachverantwortung.
Gibt es auch strukturelle Massnahmen, die sich rascher umsetzen lassen?
Daniela Wirz: Nicht ganz schnell, aber doch schneller als ein sozialpolitischer Wandel, ist die Einbindung von Quereinsteiger:innen. Wir kennen die konkrete Zielgruppe noch nicht, können aber einmal breit an Zugewanderte, an Menschen mit Qualifikationen in einem anderen Bereich, Freiwillige, Pensionierte oder eben auch Konzepte von Service User Involvement denken. Es gibt viele interessante Ansätze und es ist wichtig, dass wir sie gut und bald prüfen, um diese Personen für die Arbeit in der Praxis zu qualifizieren.
Ausbalanciertes Angebotssystem
Wissenschaftlich begleitet und nach Abschluss evaluiert wird das Pilotprojekt von der ZHAW Soziale Arbeit. Martial Jossi, der diesen wissenschaftlichen Teil leitet, sagt: «Die Wohnungssuche gestaltet sich für sehr viele Menschen in der Schweiz schwierig, vor allem in den Ballungszentren. Personen mit multiplen Problemlagen, die von Wohnungs- oder Obdachlosigkeit betroffen sind, sind daher besonders belastet.» Gerade deshalb sei der «Housing First»-Ansatz so wichtig, betont Jossi: «Die Teilnehmenden schliessen neu einen eigenen Mietvertrag ab, dann folgt eine individuelle und selbstbestimmte Betreuung durch das zuständige ‹Housing First›-Team.»
Es zeigt sich auch an diesem Beispiel gut, wie wichtig es ist, den grundlegenden Ansatz von «Housing First» an die jeweiligen örtlichen und sozialen Situationen anzupassen. Zwar hat sich etwa auch in den USA viel getan in den letzten Jahren. Und doch unterscheidet sich das soziale Sicherungssystem stark von dem in der Schweiz oder anderen europäischen Ländern. Wie ist es also möglich, diesen neuen, gänzlich anderen Ansatz von Wohnungshilfe neben dem bereits etablierten System umzusetzen?
Neue Eventreihe: «Forum S»
Im Herbst 2024 startet an der ZHAW Soziale Arbeit die neue Veranstaltungsreihe «Forum S – Diskurs Reflexion Kritik». In diesem Format werden aktuelle sozial- und gesellschaftspolitische Fragen mit Gäst:innen diskutiert. «Forum S» fördert fachliche Reflexion und kritischen Diskurs. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende, Mitarbeitende, Fachpersonen aus der Praxis sowie weitere Interessierte, die sich mit der Disziplin und Profession der Sozialen Arbeit auseinandersetzen.
SUSANNE BECKER lehrt im Studiengang Soziale Arbeit an der IU Internationale Hochschule in Deutschland. Die Soziologin leitet Workshops zu Klassismus und ist Social Justice & Diversity Trainerin. Becker ist die erste Gästin der neuen Veranstaltungsreihe «Forum S».
Veranstaltung zum Fachkräftemangel in Sozialer Arbeit
Haben Sie Erfahrung mit Fachkräftemangel in Ihrer sozialen Organisation?
Bei der Veranstaltung vom 5. Dezember 2023 beschäftigen wir uns mit folgenden Fragen:
- Welche Faktoren tragen zum Fachkräftemangel bei, und wie können wir ihnen entgegentreten?
- Welche kreativen Ansätze und bewährten Praktiken gibt es, um Fachkräfte für die Soziale Arbeit zu gewinnen und im Berufsfeld zu halten?
- Wie können Bildungsinsitutionen, Praxispartner:innen und Behörden für eine Lösung zusammenspannen?
Wir sind gespannt auf Ihre Analyse des Fachkräftemangels und Ihre Ideen, diesen zu entschärfen.
Weitere Informationen und Anmeldung

«Hierzulande gibt es bereits viele Angebote, die bereits ähnlich wie ‹Housing First› oder nach einzelnen Prinzipien dieses Ansatzes funktionieren und damit erfolgreich sind», sagt Martial Jossi. Wichtig sei, dass man «Housing First» als ganzheitlichen neuen Ansatz in der Obdachlosenhilfe verstehe. Angebote, die sich danach ausrichten, sollten dementsprechend konzipiert und ausgestaltet werden.
Ganz konkret werden im Leitfaden «Housing First Guide Europe» die acht Grundprinzipien beschrieben: Wohnen ist ein Menschenrecht; Nutzer: innen müssen sich nicht zu einer Behandlung oder Betreuung verpflichten und sie haben Wahlfreiheit und Entscheidungsmöglichkeiten; das ganzheitliche Wohlbefinden steht im Fokus (Recovery-Orientierung); Drogen- und Alkoholkonsum sind nicht verboten, sondern man versucht in der Betreuung, den problematischen Konsum zu vermindern (Harm-Reduction); aktive Beteiligung ohne Druck und Zwang; personenzentrierte Hilfeplanung; flexible Hilfen so lange wie nötig.
Angebotssystem weiterentwickeln
Doch wie sieht es mit dem generellen Bedarf für «Housing First» in der Stadt Zürich aus? «Wir verfügen bereits über ein sehr gut ausbalanciertes Angebotssystem, das wir laufend weiterentwickeln», ordnet Stefan Bäni den Ansatz im lokalen Kontext ein. Und zumindest im niederschwelligsten Angebot, der Notschlafstelle, können sie derzeit auch keine signifikante Zunahme von schwer psychisch kranken Obdachlosen feststellen.
«Dennoch», so Bäni, «leiden 96 Prozent aller erwachsenen Einzelpersonen in unseren Einrichtungen an mindestens einer psychischen Erkrankung.» Dies zeige die gemeinsame Studie des Geschäftsbereichs Wohnen und Obdach und der Städtischen Gesundheitsdienste, kurz WOPP-Studie, aus dem Jahr 2021. Laut dieser Untersuchung hat sich der psychische Gesundheitszustand der Klient: innen weiter verschlechtert.
In den kommenden Jahren weiterverfolgt wird der «Housing First»-Ansatz auch in Basel. «Wir bleiben hoffentlich dran», sagt Thomas Frommherz. Die Heilsarmee bewerbe sich für das fixe Mandat, in welches das Pilotprojekt bald überführt wird. Hilfreich seien ausserdem neue Bau- und Wohnprojekte sowie Kooperationen wie etwa mit der Christoph-Merian-Stiftung. Auch dort habe «Housing First» bereits einen Funken gezündet.
Wohlstandsgefälle begünstigt Kinderhandel
Dieser Fall zeigt, dass es bei den Adoptionen von Kindern aus Sri Lanka zu Missbrauch kam, wenn es darum ging, die unerfüllten Kinderwünsche von Ehepaaren aus reichen westlichen Industrieländern wie Deutschland, Schweden oder der Schweiz zu erfüllen. Beauftragt vom Bundesamt für Justiz, hat nun das Institut für Kindheit, Jugend und Familie des Departementes Soziale Arbeit der ZHAW in einem Forschungsprojekt unter der Leitung von Nadja Ramsauer dieses dunkle Kapitel historisch aufgearbeitet.
Um die unerfüllten Kinderwünsche von Paaren aus reichen Ländern zu befriedigen, entstand in Sri Lanka in der zweiten Hälfte der 1970er-Jahre ein regelrechter Adoptionsmarkt, der von einem Netzwerk von Anwälten und Agentinnen beherrscht wurde. Die Vermittlung von sri-lankischen Adoptivkindern war für die Akteure vor Ort aufgrund des grossen Armuts- und Lohngefälles zwischen den beteiligten Ländern lukrativ, was Korruption begünstigte. In den 1980er-Jahren gelangten Tausende von sri-lankischen Kindern unter zweifelhaften, mitunter illegalen Bedingungen in europäische Länder. Die Schweizer Behörden stellten zwischen 1973 und 1997 insgesamt 950 Einreisebewilligungen für Kinder aus Sri Lanka aus. Trotz alarmierender Berichte erwogen sie nie einen Einreisestopp.
Behörden beugen sich dem Lobbying
In Sri Lanka selbst wurde seit 1981 kritisch über diese illegalen Adoptionen berichtet und der Kinderhandel wurde unmissverständlich offengelegt. Hierzulande erfuhren nicht nur die Bundes- und Kantonsbehörden davon, sondern auch eine breite Öffentlichkeit: Wer eine Tageszeitung oder Wochenzeitschrift las, war darüber bereits im Frühjahr 1982 im Bild. Doch die aufgedeckten Kinderhandelsnetze waren für viele der hiesigen Adoptionsinteressenten kein Grund, auf die Erfüllung ihres Kinderwunsches zu verzichten. Viele reisten nach Sri Lanka, oft auch ohne eine von den Behörden anerkannte Vermittlungsstelle beizuziehen. Doch auch diese Vermittlungsstellen waren keine Garantie dafür, dass die Annahme eines sri-lankischen Babys gesetzeskonform verlief. Mitunter wurden auch die Adoptiveltern getäuscht.
Gerade die anerkannten Vermittlungsstellen machten bei den Schweizer Behörden Druck, Auslandsadoptionen unter gelockerten Rahmenbedingungen abzuwickeln. Der Gründer von Terre des hommes, Edmond Kaiser, lobbyierte dafür in den 1970er-Jahren in Bern. Ebenso die St. Galler Vermittlerin Alice Honegger, die 1984 gemeinsam mit dem St. Galler CVP-Nationalrat Edgar Oehler beim Bundesamt für Ausländerfragen, dem heutigen Staatssekretariat für Migration, eine erleichterte Einreisepraxis durchbrachte.
Aufsicht versagt
Gravierend fällt in der historischen Bewertung aus, dass die Behörden beim Bund und in den Kantonen früh Kenntnis über den kommerziellen und teilweise illegalen Charakter der Vermittlungen hatten. Trotzdem konnten Kinder aus Sri Lanka ohne Zustimmungserklärung ihrer leiblichen Eltern einreisen. Die zuständige St. Galler Aufsichtsbehörde liess die Vermittlerin Alice Honegger jahrzehntelang gewähren, obwohl sich Klage an Klage reihte und Alice Honegger sich immer wieder über die behördlichen Anordnungen und Verbote hinwegsetzte.
Den Schweizer Behörden war bekannt, dass in Colombo Kinder gegen Geld, Güter des täglichen Bedarfs und Luxuswaren eingetauscht wurden. Die Personen, die Kinder aus Sri Lanka in die Schweiz vermittelten, waren Teil eines korrupten Systems wie Dawn de Silva oder die Anwältin Rukmani Thavanesan-Fernando. Andere dockten an dieses System an wie die St. Galler Fürsorgerin Alice Honegger und für kurze Zeit auch Terre des hommes Lausanne.
Die Schweiz und Sri Lanka arbeiteten in dieser Angelegenheit nicht zusammen, um den Kinderhandel gemeinsam einzudämmen. Nicht einmal ein sri-lankischer Minister, den der Geschäftsträger der schweizerischen Botschaft Claude Ochsenbein zu einer Unterredung nach Bern schicken wollte, war willkommen. Vielmehr berief sich das Bundesamt für Ausländerfragen auf seinen begrenzten Zuständigkeitsbereich und schob das Problem an die schweizerische Vertretung in Colombo ab.
Mangelhafte Adoptionsverfahren in den Kantonen
Bei den Adoptionsverfahren zeigte sich, dass auch die Vertreter der Kantons- und Gemeindebehörden nicht genau hingeschaut und fehlende oder widersprüchliche Dokumente akzeptierten. Auf klaren Herkunftsangaben und Zustimmungserklärungen von leiblichen Eltern zu bestehen, wäre trotz der kleinteiligen föderalistischen Verteilung von Kompetenzen möglich und eine sorgfältige Prüfung bereits bei der Einreise notwendig gewesen: Denn kam ein sri-lankisches Kind in die Schweiz, lebte es zunächst während zwei Jahren als Pflegekind in einer Familie. Bei einem ablehnenden Adoptionsentscheid hätte es kaum mehr in seine Heimat zurückgeschickt werden können. Alles in allem wurde deutlich, dass Kinder für Eltern gesucht wurden und nicht Eltern für Kinder.
Nachbarschaft von Sozialer Arbeit und Kunst
Hierzulande weist soziokulturelle Arbeit schon lange eine gewisse Nähe zu spielerischer, musischer, gestalterischer Arbeit und letztlich zu einer mehr oder weniger künstlerischen Herangehensweise auf. Exemplarisch zeigt sich dies in den Zürcher Gemeinschaftszentren: Hervorgegangen aus den Robinson-Spielplätzen der 50er und frühen 60er Jahre, verfügen viele dieser soziokulturellen Quartiertreffs über gut ausgestattete Werkstätten und Labors und bieten Räume für Musik, Tanz und Theater.
Wenngleich die soziokulturelle Animation in der Schweiz gemeinhin der Sozialen Arbeit zugeordnet ist, kann sie also auch als Brücke hin zu den Künsten begriffen werden. Allein das dem Begriff der Soziokultur innewohnende Interesse an der Kultur darf als Antenne in die Sphäre der Künste gelesen werden. Dieses Ausgreifen der Sozialen Arbeit lässt sich unter dem Zusatz der Kunstorientierung noch akzentuieren. Wenn von «Kunstorientierter soziokultureller Animation» die Rede ist, dann liegt dem ein Verständnis animatorischer Praxis zugrunde, welches einerseits sozialarbeiterische und sozialpädagogische Methoden mit den Künsten in Verbindung bringt und umgekehrt Vermittlung und Pädagogik in den Künsten mit dem Blick auf soziale Aufgabenstellungen und Problemlagen betreibt.
Projekt «Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!»
Vor diesem Hintergrund realisierte die ZHAW Soziale Arbeit das Projekt «Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!». Das Forschungs- und Entwicklungsprojekt untersuchte, wie Pflegekinder auf den Übergang in die Selbständigkeit vorbereitet werden, wie sie diese Vorbereitung einschätzen, wie sie den Auszug aus der Pflegefamilie erlebten und welche Unterstützung sie für den Übergang ins Erwachsenenalter benötigt hätten. Das Projekt wird von der Stiftung Mercator Schweiz finanziert.
Ziel des partizipativen Projekts ist es, Pflegekinder stärker an der Vorbereitung auf den Übergang in die Selbständigkeit zu beteiligen. Im Zentrum stehen deshalb die Ideen und Vorschläge von (ehemaligen) Pflegekindern. Ihre Erfahrungen und Bedürfnisse wurden mit einer Befragung erfasst. Zudem begleitete eine Gruppe von ehemaligen Pflegekindern das ZHAW Forschungsteam während der gesamten Projektdauer in regelmässigen Treffen kritisch. Diese Begleitgruppe nimmt verschiedene Aufgaben wahr und wirkte insbesondere bei der Entwicklung von Unterstützungsangeboten mit. Basierend auf den Ergebnissen des Projekts entstanden ein Mentoring-Programm und eine Website.
Empfehlungen statt Verbindlichkeit
Dies bedeutet konkret: Der Grundbedarf für den Lebensunterhalt wird gesenkt und viele Betroffene müssen ihre Wohnung aufgeben und in eine Kollektivunterkunft ziehen. Zudem besteht die Gefahr, dass Integrationsmassnahmen nicht mehr finanziert werden. Das Geld reicht nicht mehr für grundlegende Dinge wie ein Busticket für die Lokalzone, Medikamente oder Spielgruppenplätze. Wie das neue Gesetz konkret umgesetzt wird, kann jede Gemeinde selbst entscheiden. Das heisst, je nachdem, in welcher Gemeinde jemand wohnt, fallen die gezahlten Gelder unterschiedlich tief aus. Eine Einzelperson ab 25 Jahren erhält in Dielsdorf beispielsweise CHF 300 im Monat für Mietkosten. Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS empfiehlt in ihren Richtlinien einen Betrag von CHF 1200. Zürich ist eine der Gemeinden, die sich an den SKOS-Richtlinien orientieren und sich dafür aussprachen, die Mietkostenbeiträge nicht zu senken. Doch auch hier – im besten Fall also – erfahren die Betroffenen eine Kürzung um ein Drittel ihrer bisherigen Unterstützungsleistungen. «Gemeindelotto» nennt Moritz Wyder, Geschäftsleiter des Vereins map-F, diesen Zustand, der in seiner Brisanz noch dadurch verstärkt wird, dass vorläufig aufgenommene Personen, die auf Asylfürsorge angewiesen sind, die Gemeinde neu nicht mehr wechseln dürfen. Selbst wenn sie woanders eine bezahlbare Wohnung finden, was schwierig genug ist.
Was macht eigentlich ein Institut für Sozialmanagement?
Marianne: Wir beraten, begleiten und bilden Menschen aus, die in Non-Profit-Organisationen ihr berufliches Handeln professioneller, innovativer und zukunftsweisend reflektieren und gestalten wollen und wissenschaftlich fundieren möchten. Zugleich erforschen wir mit unseren Praxispartnerinnen und -partnern z.B. Partizipationsprozesse oder die Konstruktion von Wirksamkeit.
Christian: Wir hängen uns rein. In alles, was Akteuren und Organisationen hilft, besser zu arbeiten und besser zusammenzuarbeiten. Zu uns kommen Leute aus dem Sozialen, aus der Bildung und aus der Gesundheit. Wir sind selbst ein transdisziplinärer Haufen, und wir brennen für diese Themen.
Welche Faktoren entscheiden über die Nutzung?
Die Studie zeigt, dass die Schweiz über ein vielfältiges Angebot verfügt. Dieses ist aber teilweise nicht auf die Bedürfnisse der Zielgruppen ausgerichtet und weist im Kinder- und Erwachsenenbereich Versorgungslücken auf.
Der entscheidende Einflussfaktor für die Nutzung einer Tages- oder Nachtstruktur ist der Leidensdruck der Angehörigen. Eine bedeutende Rolle spielen zudem der Pflege- und Betreuungsbedarf, die Lebenslage der Nutzerinnen und Nutzer sowie ihrer Angehörigen, die Finanzierung des Aufenthalts, das konkrete Angebot in der Region sowie die Niederschwelligkeit der Tages- und Nachtstruktur in Form flexibler Öffnungszeiten, kurzfristiger Nutzungsmöglichkeiten und eines Fahrdienstes.
Rentenbeziehende mit mehr als einer Heimat
Sozialarbeitende in Beratungsangeboten im Alters- und Migrationsbereich haben zunehmend mit dieser Personengruppe zu tun. Ergebnisse aus früheren Studien zeigen, dass transnationale Lebensmuster zumindest für einen Teil von ihnen eine grosse Bedeutung haben. Sie pendeln beispielsweise zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland, leisten finanzielle Transfers ins Herkunftsland oder bieten umfangreiche Unterstützung, die nicht nur finanzieller Art ist (z.B. pflegerische, administrative und emotionale Unterstützungsbeziehungen zwischen Herkunfts- und Aufnahmeland). Diese transnationalen Bezüge fordern die Soziale Arbeit, die bisher eher lokal orientiert ist, heraus.
Foster Care and Diversity
After a warm and stimulating welcome by Prof. Dr. Dorothea Christ, Director of the Center for Development and Services of the ZHAW, School of Social Work, the participants were welcomed and introduced to the conference topic by ZHAW Foster Care Researchers Dr. Daniela Reimer, Prof. Karin Werner and Renate Stohler.
Lectures on diversity and youth welfare by Prof. Dr. Stefan Köngeter (FH St Gallen) and on the relationship between diversity and foster care by Prof. Dr. Klaus Wolf (University of Siegen) set an excellent framework for the topic on the first day of the conference. Prof. Dr. Andreas Bernard (Leuphana University Lüneburg) gave a lecture on "New reproductive technologies and the new order of the family", providing a stimulating view of the conference topic from the outside.
The conference topic was discussed in depth on both days in various parallel workshop sessions featuring a total of 33 presentations. The relationship between diversity and normality, the relationship between special circumstances and general foster care issues, the (lack of) diversity of social services and thematic gaps were emphasized again and again. Among other things, it became clear that in many countries, birth families still receive little attention in foster care – both in research and in practice. Dr. Hélène Join-Lambert (Univ. Paris-Nanterre) and Dr. Daniela Reimer (ZHAW) summarized these points in their final contribution.
von Tim Tausendfreund und Ida Ofelia Brink
«Ich kann nicht entscheiden: ‹Wir gehen jetzt auf den Mond!› Die Eltern könnten ja vielleicht sagen: ‹Wir wollen lieber auf den Mars.› Aber wenn ich erwachsen bin und allein, dann kann ich sagen: ‹Ich möchte auf den Mond und nicht auf den Mars!› Und niemand kann mir sagen: ‹Du darfst nicht!›»
So lautet die Antwort eines Kindes auf die Frage, wie es über seine Zukunft denkt. Sie stammt aus Diskussionen, die wir ergänzend zur grossangelegten Befragung der «Children’s Worlds»Studie durchgeführt haben. Und sie macht deutlich: Es ist wichtig, dass Kinder mitbestimmen können.
Geleitet von ethischen Prinzipien
Zum Beispiel braucht es viele andere Menschen, damit das Aufwachsen gut gelingt. Aber nicht nur dafür. Man kann sagen: Es braucht die anderen. Immer. In manchen Fällen braucht es sie, weil die Lebenswelt klein ist und der Anregungen wenig sind. In anderen Fällen sind die anderen nötig, weil die eigene Lebenswelt zu schnell gross wird und man sich darin zu verlieren droht.
Das erste, für zwei Jahre geltende Motto des WSWD entstammt der «Globalen Agenda für Soziale Arbeit und Soziale Entwicklung 2020 – 2030», welche sich die Mitglieder der drei weltweit grössten Verbände für Soziale Arbeit gegeben haben. Es sind dies der International Council of Social Welfare (ICSW), die International Association of Schools of Social Work (IASSW) sowie die International Federation of Social Workers (IFSW). Das Thema der Global Agenda, ist die «Stärkung der Sozialen Solidarität und Globalen Verbundenheit». Geleitet von ethischen Prinzipien, haben Soziale Arbeit und ihre Fachpersonen eine tragende Rolle inne, Menschen, Gemeinschaften und Systeme so miteinander zu verbinden, dass Transformation sozial, inklusiv und nachhaltig auch gelingt.
Erbitterte Frauen, gleichgültige Ratsherren
Das reicht nicht aus. Im Namen des Vorstands der Frauenzentrale fordert Emmi Bloch schliesslich die Regierung auf, die Forderungen der Demonstrantinnen zu überprüfen und diese anzuhören. Ausserdem soll der Kantonsrat das Ausmass der Unterernährung erheben und das Rationierungssystem ausbauen.
Nachdem es wenige Tage später erneut zu einer Solidaritätskundgebung kommt, diesmal mit 15'000 Menschen, reichen am 17. Juni zum ersten Mal Frauen in Zürich eine Volkspetition ein. Bloch, selbst keine der Demonstrantinnen, ist an der Sitzung dabei und schreibt an jenem Abend in ihr Tagebuch: «Wahnsinnig gesteigerte Erbitterung einerseits, sträfliche Gleichgültigkeit andrerseits. Sie [die Bürgerlichen] sind ja, wie unsere vielen Frauen, eng befangen im eigenen Wesen und finden nicht den Weg, der sie an die Not der andern glauben lässt.»
Video-Aufzeichnung
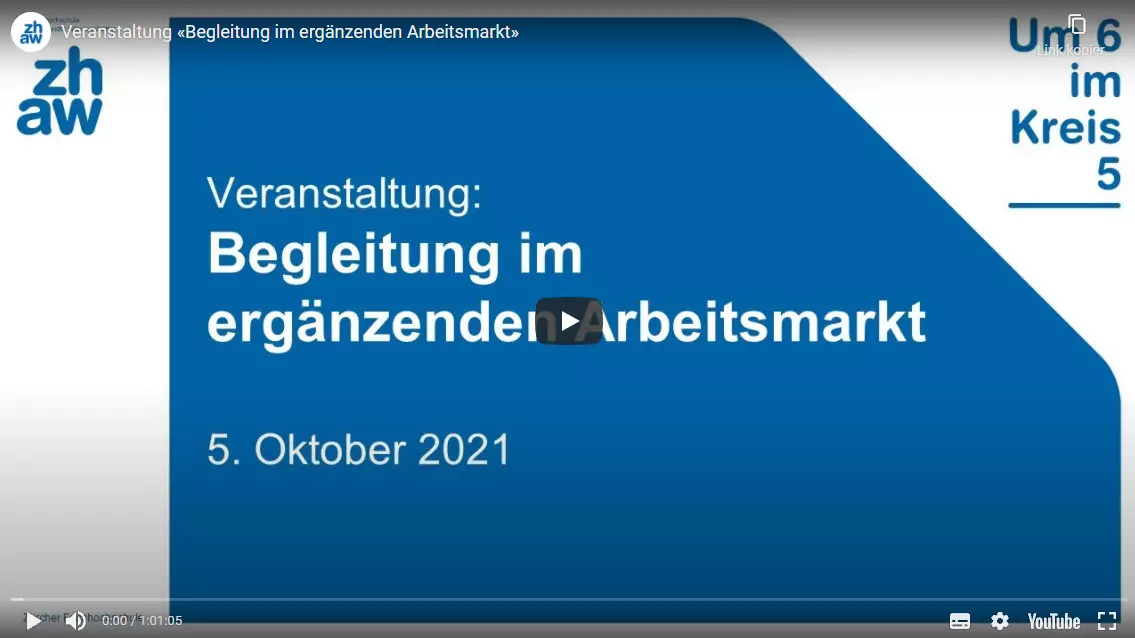
Handlungsmöglichkeiten aus Teilnehmendensicht
Die Veranstaltung ist auf grossen Anklang gestossen. Die im Themeneinstieg von den Podiumsgästen ausgeführte Ausgangslage rund um Ermessen in der Sozialhilfe wurde durch eine Publikumsbefragung ergänzt: Problematische Aspekte des Ermessens in der wirtschaftlichen Sozialhilfe zeigen sich dergemäss häufig auf struktureller Ebene: Zeitdruck, komplexe Dokumentations- und Regelwerke, aber auch wenig Raum zur gemeinsamen Entwicklung von Haltungen oder fehlende Zeit zum Üben erschweren Sozialarbeitenden das eigentlich hochinteressante Ermessen im Individualfall. Die Veranstaltungsteilnehmenden priorisierten entsprechend sowohl Verbesserungsmassnahmen auf organisationaler wie auch auf der Ebene der Ausbildung und Weiterbildung: Ermessen soll und darf Spass machen und organisationale Rahmenbedingungen müssen so gestaltet werden, dass Sozialarbeitende das Handwerk des Ermessens üben und reflektieren können. Schliesslich obliegt es der Hochschule, der gesetzlichen Sozialen Arbeit mehr Gewicht zu geben und Lust auf die alltägliche berufliche Auseinandersetzung im Spannungsfeld der wirtschaftlichen Sozialhilfe zu schaffen.
Ab 2022 plant die ZHAW Soziale Arbeit einen regelmässigen Fachaustausch mit der Praxis zum Thema Existenzsicherung. Interessierte melden sich bitte unter der folgenden E-Mail-Adresse: netzwerkexistenzsicherung.sozialearbeit@zhaw.ch
Video-Aufzeichnung
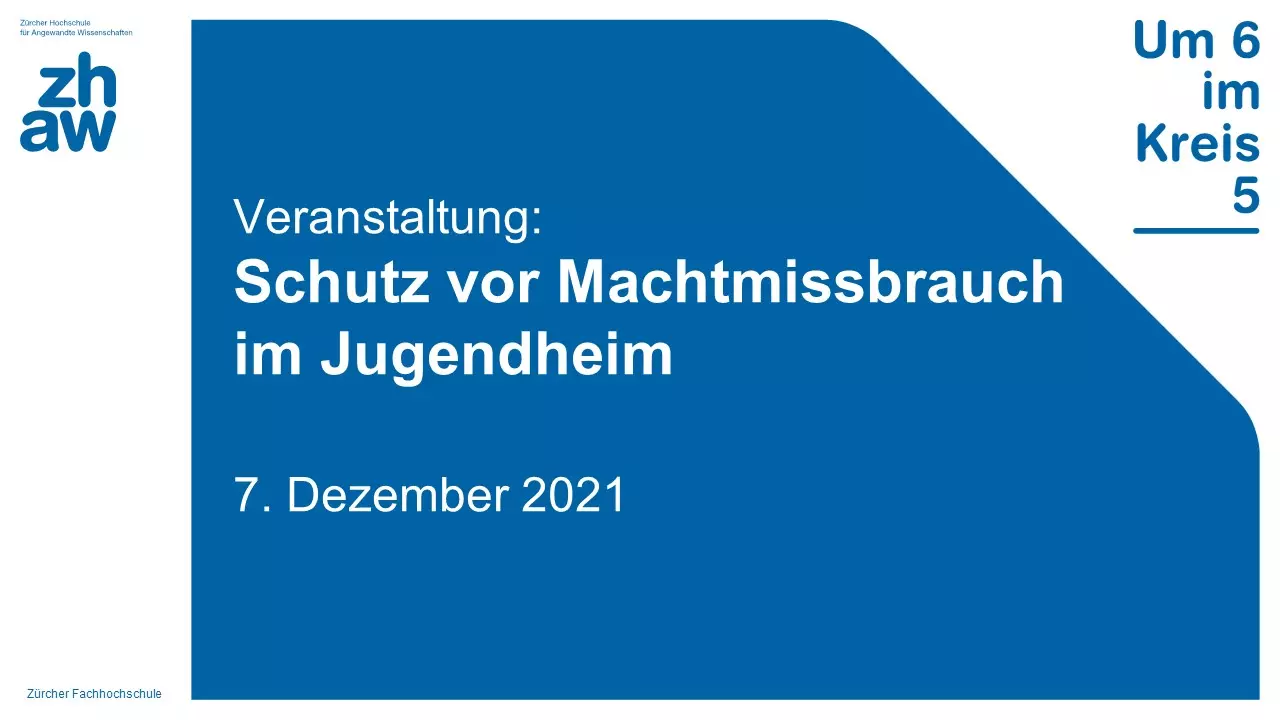
Video-Aufzeichnung
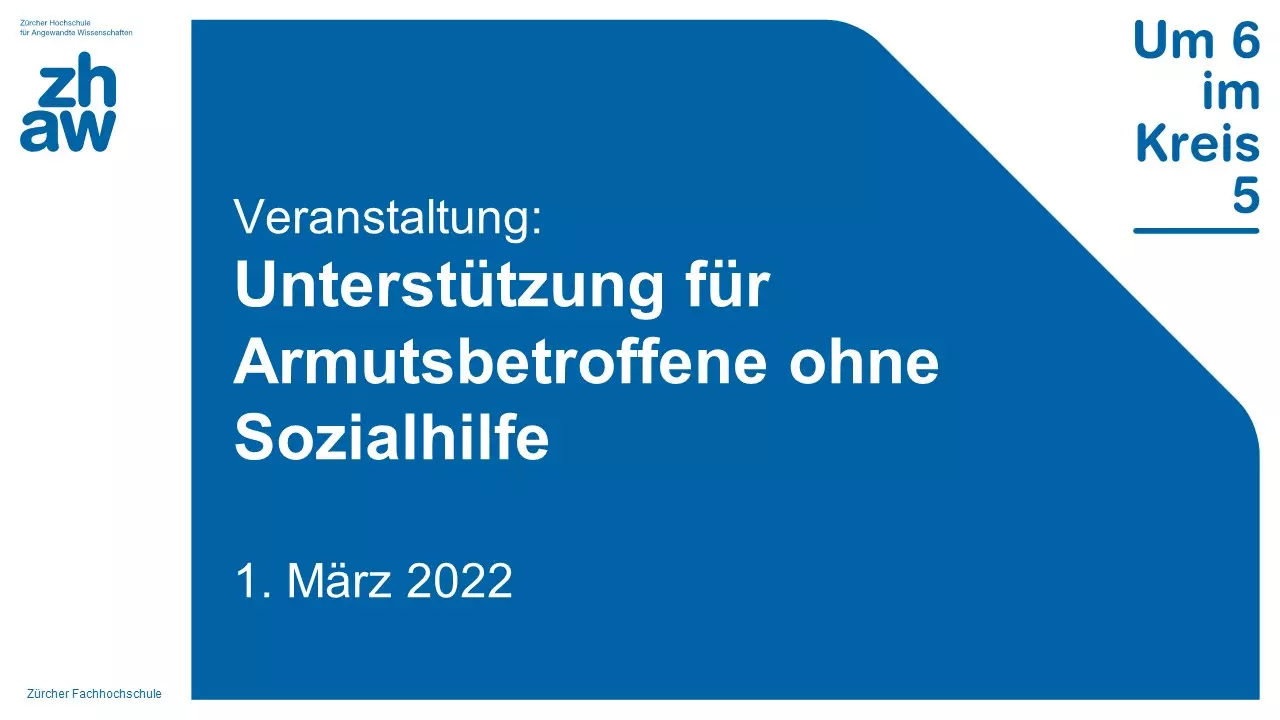
Video-Aufzeichnung
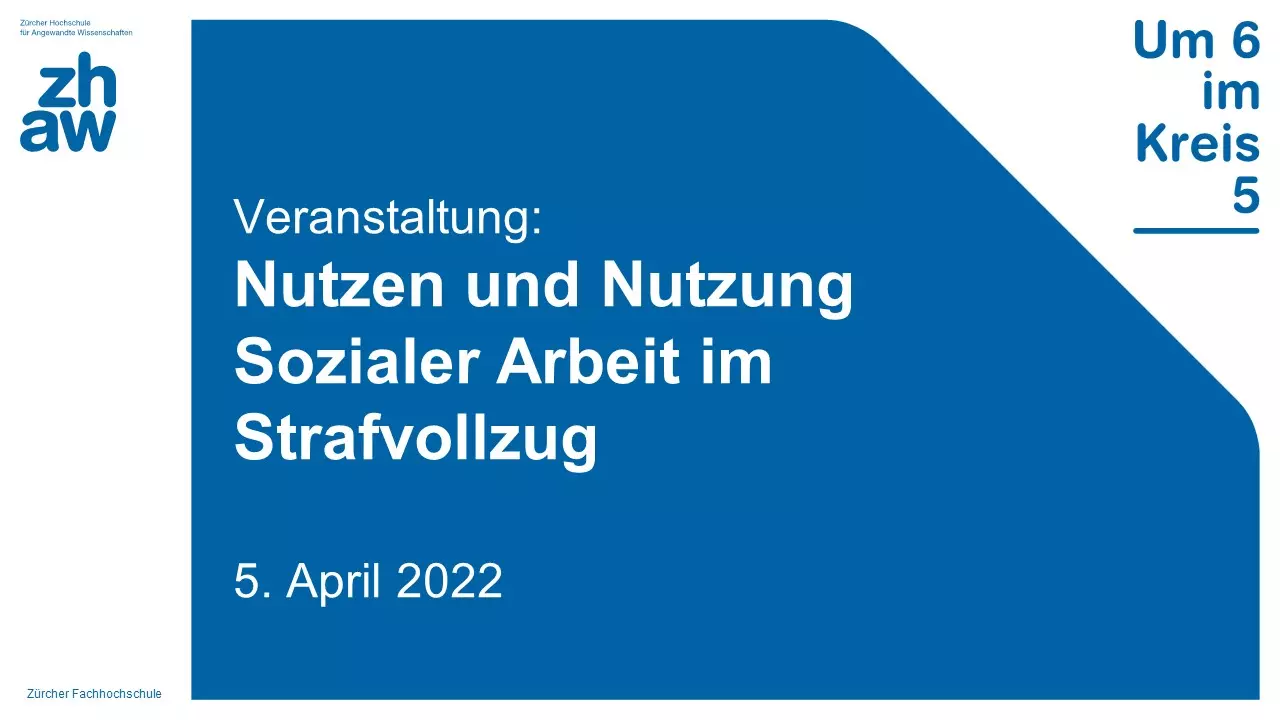
Video-Aufzeichnung
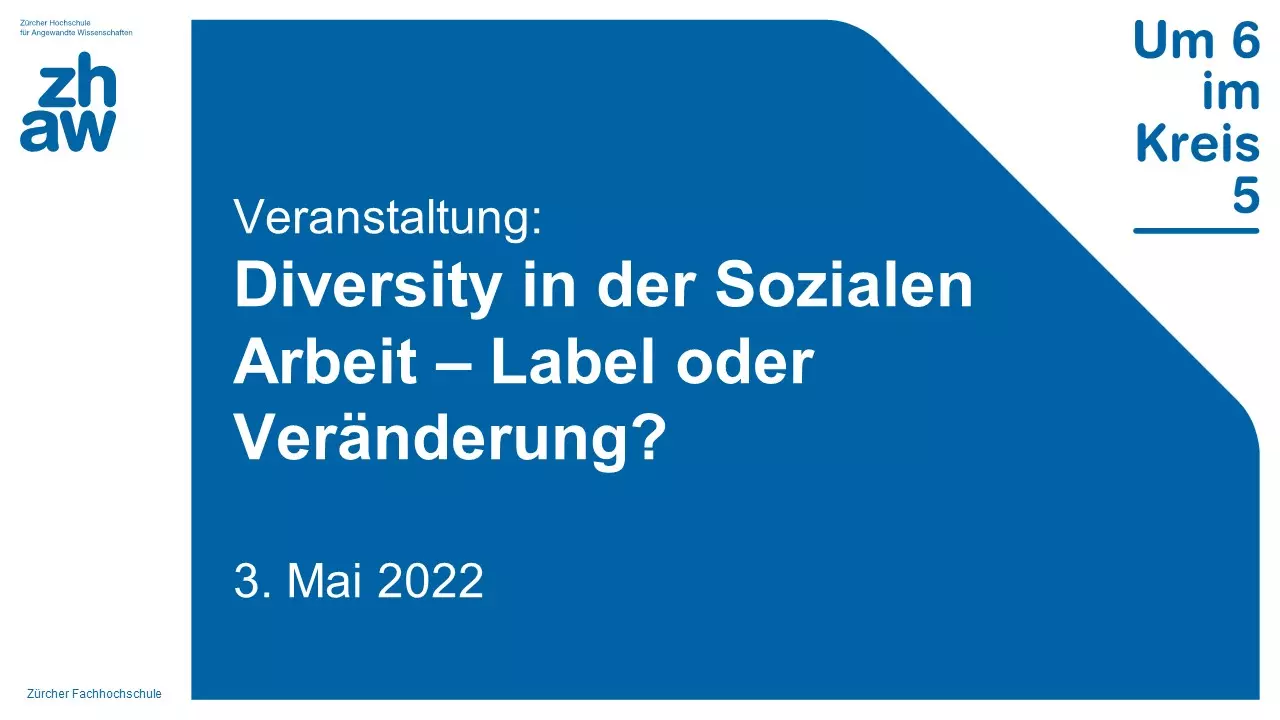
Studentischer Lehrpreis
Video-Aufzeichnung
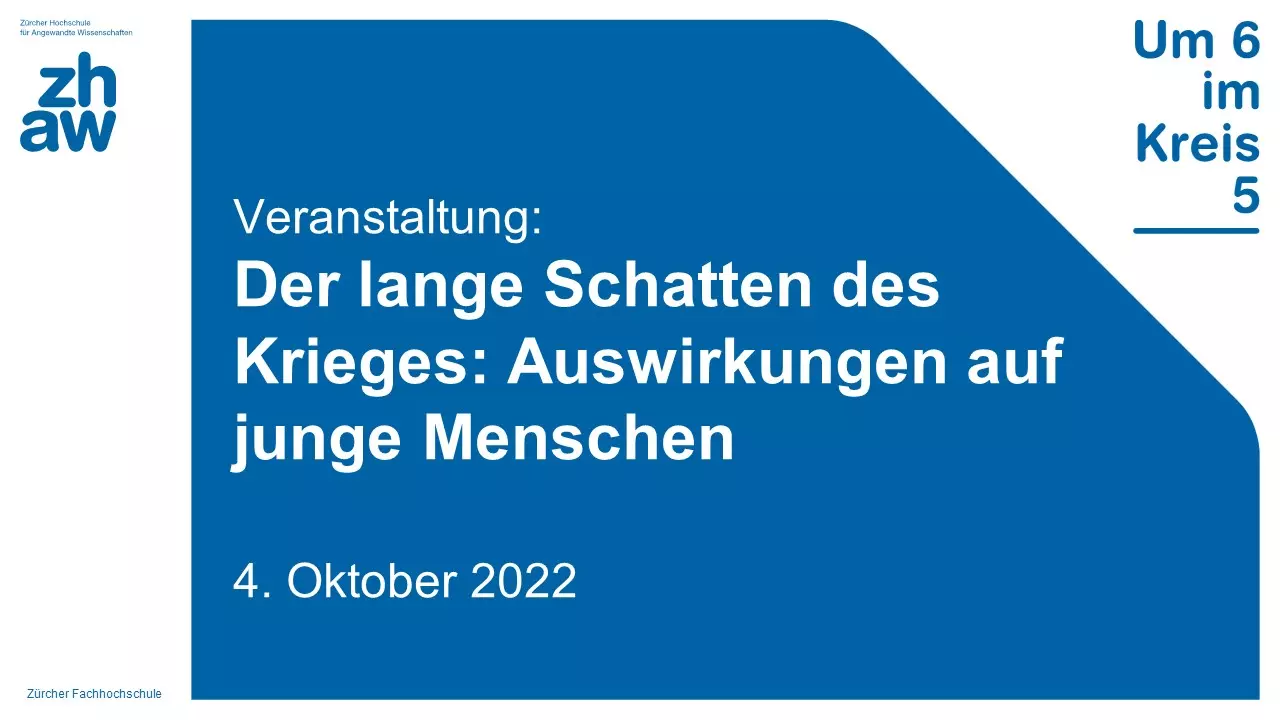
Video-Aufzeichnung
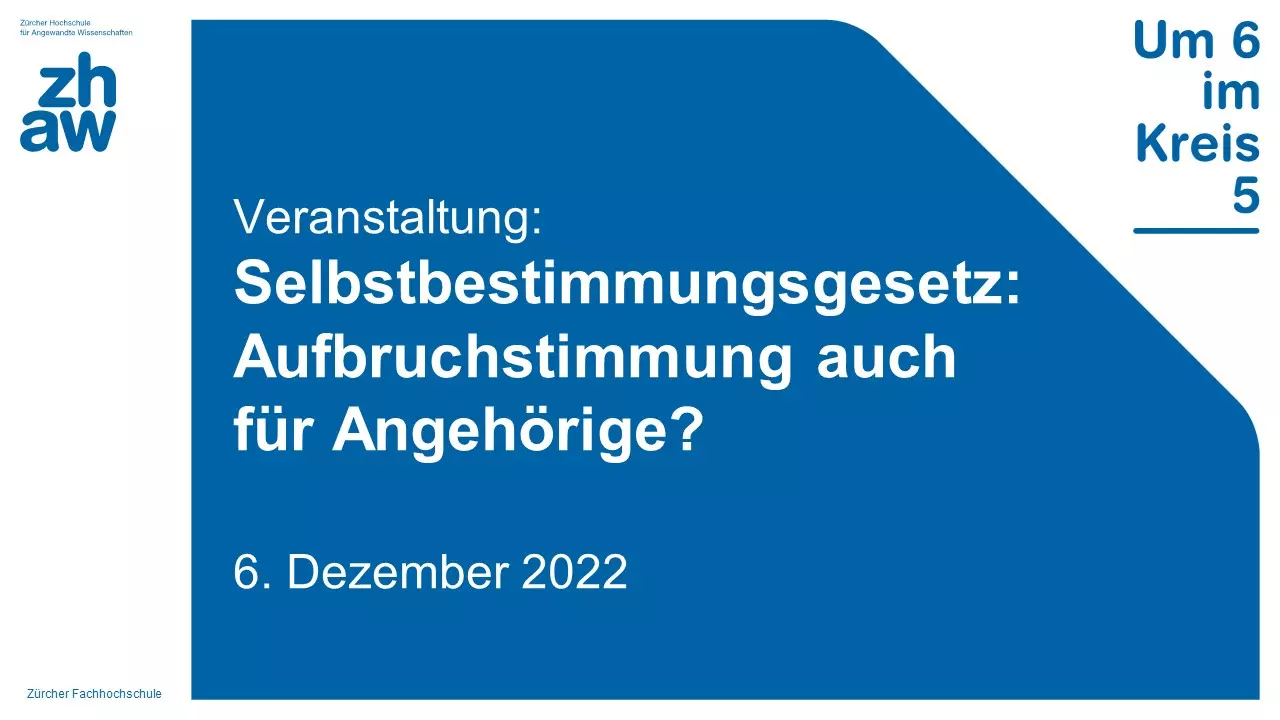
Downloads
Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:
Präsentation «Der lange Schatten des Krieges: Auswirkungen auf junge Menschen» (PDF 1.37 MB)
Downloads
Nachfolgend können Sie die Präsentation zur Veranstaltung als PDF herunterladen:
Präsentation «Selbstbestimmungsgesetz: Aufbruchstimmung auch für Angehörige?» (PDF 538 kB)
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Gemeinsames Weiterbildungsangebot zweier Hochschulen
Auf der spannenden Nachbarschaft von Fachmitarbeitenden, welche mit unterschiedlichen professionellen Prägungen im soziokulturellen Feld tätig sind, fusst auch der Zertifikatslehrgang CAS Werkstatt Soziokultur. Dieser fand – seine Vorläuferkurse eingerechnet – seit 2005 alle zwei Jahre statt. Grundlage war stets und ist immer noch die Kooperation zweier Zürcher Hochschulen: der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften, wo auch die Soziale Arbeit verortet ist, und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), wo Kunstvermittlung und Kunstpädagogik in verschiedenen Sparten gelehrt wird. Aus dieser langjährigen Zusammenarbeit entwickelte sich eine spannungsvolle und fruchtbare Auseinandersetzung mit dem jeweiligen professionellen Selbstverständnis und mit den unterschiedlich geprägten methodischen Herangehensweisen an soziokulturelle Arbeit.
map-F – ein Verein setzt sich ein
Als das Stimmvolk im Kanton Zürich im September 2017 entschied, dass vorläufig Aufgenommenen die Leistungen gekürzt werden sollen, haben sich Vertreterinnen und Vertreter des «Nein-Komitees» zusammengetan und map-F gegründet. Der Verein macht sich für vorläufig aufgenommene Personen stark und dient ihnen und von der Gesetzesänderung betroffenen Organisationen und Behörden als Anlaufstelle. Eines seiner wichtigsten Anliegen: Es sollen angemessene Mindeststandards festgelegt werden, die für alle Zürcher Gemeinden verbindlich sind. Durch Öffentlichkeitsarbeit und Einflussnahme auf den gesellschaftspolitischen Diskurs sollen zudem die Situation für die Betroffenen langfristig verbessert und deren Integration gefördert werden.
Moritz Wyder hat einen Bachelorabschluss in Sozialer Arbeit von der ZHAW und ist seit April 2018 Geschäftsleiter von map-F. Dass die Gesetzesänderung eine Verschlechterung für die betroffenen Menschen bringen würde, sei klar gewesen, sagt er: «Der Verein sucht deshalb nach Möglichkeiten, die Lebensumstände der Betroffenen zu verbessern.» Solange keine gesetzliche Veränderung bewirkt werden könne, seien die Mitarbeitenden von map-F im Direktkontakt mit den Betroffenen meist in der Rolle der Informationsvermittler. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die Gemeinden oft nicht klar und vollständig über die Gesetzesänderung und ihre Auswirkungen informieren würden. Die Mitarbeitenden von map-F erklären dann den Sachverhalt und dass es sich nicht um eine Bestrafung handle – auch wenn es sich so anfühlen möge. Durch den Kontakt mit map-F haben die Menschen zumindest die Möglichkeit, über ihre Situation zu sprechen und sich Gehör zu verschaffen. Und in manchen Fällen habe ein Rekurs durchaus Chancen und es könne eine Verbesserung erzielt werden, so Moritz Wyder. Doch der Verein sei bestrebt, mehr zu tun. Es sei den Mitarbeitenden von map-F darum wichtig, Einfluss auf den öffentlichen Diskurs zu nehmen. «Das Thema im Gespräch zu halten und langfristige Lösungen für ein Problem zu finden, das kurzfristig nicht gelöst werden kann», fasst Moritz Wyder die Ziele des Vereins zusammen.

«Wenn Prozesse nicht gut aufeinander abgestimmt sind und es im System knirscht, kann der Blick von aussen helfen.»
Wo besteht Handlungsbedarf?
Die Studie machte in fünf Bereichen einen Handlungsbedarf aus:
- Schliessen von Lücken in der Versorgung
- Bedarfsgerechtere Ausrichtung bestehender Angebote
- Verbesserte Vermittlung, Information und Begleitung durch Dritte
- Gezieltere Gestaltung der Übergänge ambulant-aufsuchend – intermediär – stationär
- Schliessen von Finanzierungslücken
Pioniere der Transnationalisierung
Transnationalitätsfragen sind in der Sozialen Arbeit selbstverständlich nicht nur im Kontext von älteren Menschen mit Migrationshintergrund relevant. Ein aktuelles Forschungsprojekt mit dem Titel «Transnationale Lebensräume und Unterstützungsnetzwerke älterer Migrantinnen und Migranten: eine Herausforderung für die Soziale Arbeit?» des Instituts für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe legt den Fokus aber auf ältere Menschen mit Migrationshintergrund, weil diese als eine Art «Pioniere der Transnationalisierung» betrachtet werden können. Die Studie geht der Frage nach, welche Implikationen die transnationale Lebensweise von Personen mit Migrationshintergrund auf konzeptionelle Grundlagen und Konzeptionen der Sozialen Arbeit hat.
Extensive exchanges, a book launch and plans for the future
The participants had time and opportunity for intensive exchanges and networking during coffee breaks as well as at the barbecue on the first evening, which was also the ideal occasion to celebrate the publication of the book “Improving education outcomes for children and young people in care: International research, policy and practice”, edited (inter alia) by two active network members, Dr. Patricia McNamara (University of Melbourne) and Dr. Carme Montserrat (University of Girona).
The network is also busy making further plans for the future: a new homepage will be launched in the coming months, a special issue with conference contributions is being prepared in cooperation with an international journal, and a short, low-threshold meeting will be held next year as part of the EUSARF 2020 Conference in Zurich.
The 11th International Foster Care Research Network Conference will take place in Barcelona in autumn 2021.
Kinder aus 35 Ländern
«Children’s Worlds» ist ein von der Jacobs Foundation geförderter Forschungsverbund, der zum dritten Mal Kinder aus der ganzen Welt befragte – zum ersten Mal auch in der Schweiz. Durchgeführt wurde die hiesige Teilstudie vom Institut für Kindheit, Jugend und Familie der ZHAW Soziale Arbeit, ermöglicht durch die Fondation Botnar und das Amt für Jugend und Berufsberatung des Kantons Zürich.
Mit einem thematisch breitgefächerten und international abgestimmten Fragebogen wurden Aussagen zum Wohlbefinden und zur Lebenssituation von Kindern gesammelt. Weltweit haben 128'000 Kinder aus 35 Ländern den Fragebogen ausgefüllt. Das ist eine grosse Chance, um Wissen über Bedarfe und Lebenslagen von jungen Menschen zu generieren und das öffentliche Bewusstsein für ihre Anliegen zu stärken.
Schwingungen zulassen
«I am Because We Are»: Dieser Satz bringt nicht nur den gesellschaftlichen Zusammenhalt selbst, sondern auch das Streiten und Ringen um Kompromisse in sozialen und politischen Spannungsfeldern zum Ausdruck. Darauf bezog sich denn auch der deutsche Soziologe Hartmut Rosa mit seinem Begriff der Resonanz: Unser Leben kann nur dann gelingen, wenn wir unsere Umwelt und unsere Mitmenschen wahrnehmen und Resonanzbeziehungen eingehen.
Wenn wir uns – um einen Begriff der Physik auszuleihen – sozusagen von den Schwingungen anderer anregen lassen. Wir verlieren damit zwar einen gewissen Anteil unserer Autonomie und unseres Individualismus, aber was wir gewinnen, ist viel mehr.
Video-Aufzeichnung
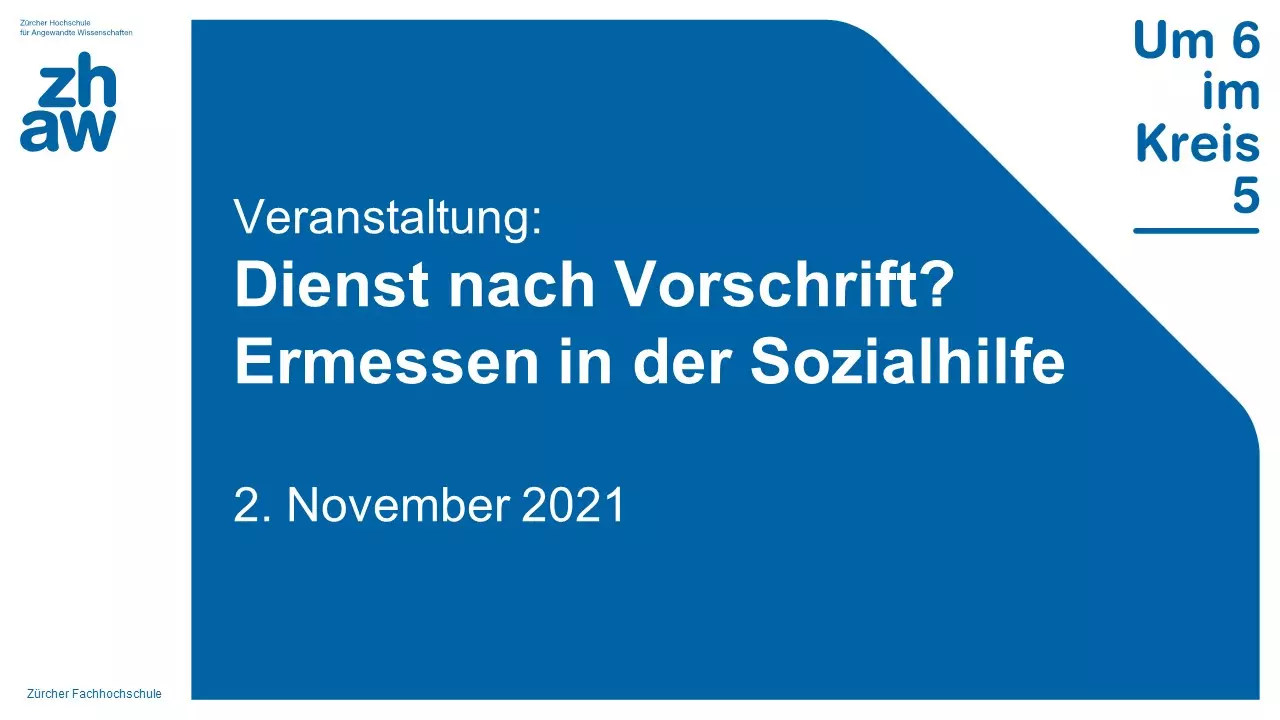
Wissenswertes zur Veranstaltung
Nachfolgend können Sie die Präsentation zum Inputreferat der Veranstaltung als PDF herunterladen:
Präsentation zur Veranstaltung «Schutz vor Machtmissbrauch im Jugendheim» (PDF 921 kB)
Erfahren Sie mehr zur Aktionsbox, die gemeinsam mit jungen Menschen im Projekt «Wie wir das sehen» der ZHAW Soziale Arbeit und Integras entstanden ist und durch die Stiftung Mercator Schweiz gefördert wurde. Sollten Sie Interesse an einer Aktionsbox «Wie wir das sehen» haben, um mit jungen Menschen u.a. über das Thema Intimität und Privatsphäre in den Austausch zu kommen und partizipatives Arbeiten zu fördern, können Sie diese hier bestellen.
Wissenswertes zur Veranstaltung
Nachfolgend können Sie die Präsentation mit den Inputreferaten als PDF herunterladen:
Veranstaltungspräsentation «Unterstützung für Armutsbetroffene ohne Sozialhilfe» (PDF 517 kB)
Erfahren Sie mehr zu der an der Veranstaltung erwähnten Studie zur Lebenslage von Armutsbetroffenen während der Pandemie.
Und falls Sie sich für die Problematik des Nichtbezugs von Sozialhilfe in der Migrationsbevölkerung und den Umgang damit in der Praxis interessieren, finden Sie in folgendem Projektbericht weitere Informationen.
Wissenswertes zur Veranstaltung
Nachfolgend können Sie die Präsentationen der Inputreferate als PDF herunterladen:
Umfrage-Resultate zum Download
Nachfolgend können Sie die Resultate der Menti-Umfrage ansehen:
Diplomfeier Bachelor und Master
Weiterführende Fragen
Man mag den Begriff kunstorientierte soziokulturellen Animation sperrig finden und als sprachlich wenig schön kritisieren. Die lange Wortfolge bietet jedoch wertvolle semantische Anknüpfungspunkte zur gedanklichen Auseinandersetzung mit dem damit abgesteckten Handlungsfeld. Die Fragen, denen es nachzugehen gilt, lauten: In welchem Verhältnis stehen künstlerische und sozialarbeiterische Praxen zueinander? Welches sind die Prägungselement der jeweiligen professionellen Sozialisation? Worin liegen die Unterschiede und worin zeigt sich Verbindendes, das im Hinblick auf eine gemeinsam weiterzuentwickelnde kunstorientierte soziokulturelle Animation füreinander fruchtbar gemacht werden kann? Diesen Fragen geht ein längerer Text nach, der als Versuch einer theoretischen Annäherung an die kunstorientierte soziokulturelle Animation zu lesen ist.
Mentoring-Projekt «Take-Off»
Pflegekinder im Übergang in die Selbständigkeit wünschen ergänzend zur professionellen Unterstützung auch eine Begleitung durch ehemalige Pflegekinder, um von deren Erfahrungen zu profitieren.
Gemeinsam mit der Begleitgruppe wurde daher das Mentoring-Projekt «Take-Off» entwickelt. Grundidee ist, dass ehemalige Pflegekinder sich als Mentorinnen und Mentoren für jüngere Pflegekinder engagieren. Auf diese Aufgabe werden sie vom Projektteam der ZHAW Soziale Arbeit vorbereitet.
Mundpropaganda und ein Netzwerk
map-F sucht den Kontakt zu Betroffenen und Organisationen. Kein einfaches Unterfangen, obschon das Angebot niederschwellig ausgelegt ist. Die Mundpropaganda funktioniert gut und die Freiwilligenorganisationen Solinetz Zürich und Freiplatzaktion, die sich ebenfalls für geflüchtete Menschen einsetzen und im zehnköpfigen Vorstand von map-F vertreten sind, dienen als Multiplikatoren. Dennoch macht sich Antje Cubela, Vorstandsmitglied von map-F und ebenfalls Absolventin des Bachelorstudiums in Sozialer Arbeit an der ZHAW, keine Illusionen: «Wir versuchen, unser Angebot niederschwellig zu halten, dennoch ist die Hürde für viele zu hoch, so ist eine Reise nach Zürich mit Kosten verbunden, die nach den Kürzungen nicht mehr zu stemmen sind.» Und auch der Austausch mit den verschiedenen Gemeinden sei nicht immer einfach. So würden einige Gemeinden kein Interesse an einer Offenlegung ihrer Praxis zeigen und sich darauf berufen, dass sie dies nicht zwingend müssen. Andere Gemeinden seien hingegen froh um Informationen und Richtlinien.
Mit welchen neuen Herausforderungen sehen sich soziale Organisationen heute verstärkt konfrontiert? Inwieweit unterstützt das ISM sie dabei?
Michael: Soziale Organisationen sind mit vielen verschiedenen Ansprüchen und Anspruchsgruppen konfrontiert. Die Lebenslage der Leistungsbezügerinnen und -bezüger ist eine Herausforderung, widersprüchliche Erwartungen von Politik, Medien und Öffentlichkeit sind andere. Eine spezielle Zeitgeisterscheinung ist die Vollkasko-Mentalität der Gesellschaft, die nach umfassender Sicherheit und Risikominimierung schreit. Das ist aber schlechterdings nicht möglich, ausser man greift zu totalitären Methoden.
Christian: Dazu kommt, dass soziale Organisationen komplexe Leistungen erbringen. Die Leistungskoordination und die Aufgabenintegration sind Knacknüsse. Wenn Prozesse nicht gut aufeinander abgestimmt sind und es im System knirscht, kann der Blick von aussen helfen.
Marianne: Die Professionalisierung von z.B. organisationalen Strukturen und Führung darf nicht auf Kosten von Sinnhaftigkeit und informellen Begegnungen beim Kaffee gehen. Laloux erinnert uns daran. Es müssen neue Formen und Gefässe geschaffen werden, damit bei flexiblen, individualisierten Teams der Zusammenhalt und die Zusammengehörigkeit nicht auf der Strecke bleiben. Passiert dies, kündigen die Menschen oder sie sind demotiviert. Wir begleiten sie darin, Lösungsmöglichkeiten zu (er)finden, die jetzt passen. Denn die herkömmlichen Modelle und Konzepte passen immer weniger. Teams wie vor 20 Jahren gibt es schlicht nicht mehr.
Was empfehlen die Forschenden?
Die ZHAW Soziale Arbeit und econcept formulierten im Rahmen der Studie verschiedene Lösungsansätze und Empfehlungen, wie dem identifizierten Handlungsbedarf begegnet werden kann. Sie setzen auf unterschiedlichen Ebenen an, wie etwa beim Angebot selbst, bei der Sensibilisierung und bei der Finanzierung. Die ausformulierten Empfehlungen können im Schlussbericht nachgelesen werden.
Erste Ergebnisse
Die Studie läuft von Januar 2018 bis März 2020. Sie will die Grundlage schaffen für eine Soziale Arbeit, die Transnationalität und ihre Konsequenzen auf Mikro-, Makro- und Mesoebene berücksichtigt und dabei auch bestehende, oft nationalstaatlich orientierte Integrationsverständnisse kritisch reflektiert.
Die Ergebnisse zeigen zum einen, dass Sozialarbeitende häufig mit transnationalen Themen konfrontiert sind. In Beratungssituationen spielen insbesondere sozialversicherungsrechtliche und migrationsrechtliche Fragen eine wichtige Rolle. Vor allem der Bezug von Ergänzungsleistungen schränkt die grenzüberschreitende Mobilität von älteren Migrantinnen und Migranten ein, und sie haben diesbezüglich einen hohen Bedarf an Informationen zu rechtlichen Bestimmungen und benötigen Unterstützung bei Anträgen und Formularen.
Zum anderen zeigt sich, dass Sozialarbeitende transnationale Lebensweisen in Beratungssituationen zwar berücksichtigen und durchaus Formen von «transnationaler Sensibilität» auszumachen sind. Allerdings erfolgt der Einbezug der transnationalen Komponente nicht systematisch und grenzüberschreitende Kooperationen mit Organisationen im Ausland fehlen weitgehend. Es stellt sich deshalb die Frage, ob diversitätsgerechte Angebote auch eine «transnationale Öffnung» der Sozialen Arbeit beinhalten müssten, um die Handlungsmöglichkeiten der Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit zu stärken und über den lokalen Kontext hinaus zu erweitern.
Presentations and material to download
- Presentation: Diversity and the Youth Welfare System (Stefan Köngeter) (PDF 1.07 MB)
- Presentation: Diversity and foster care – some general thoughts (Klaus Wolf) (PDF 328 kB)
- Presentation: Foster care and diversity? – New insights and research desiderates (Hélène Join-Lambert, Daniela Reimer) (PDF 909 kB)
- Book flyer: Education in Out-of-Home Care – International Perspectives on Policy, Practice and Research (PDF 270 kB)
«Eltern sind der Boss»
In der Schweiz nahmen über 1800 Kinder im Alter zwischen 8 und 12 Jahren teil. Ihre Antworten zeigen: Im Vergleich zu anderen Bereichen des Fragebogens nehmen sie ein relativ geringes Mass an Mitsprache wahr. Nur knapp 40% der Kinder wissen sicher, welche Rechte sie haben, und weniger als ein Fünftel kennen die UNO-Kinderrechtskonvention. Oder, wie eines der Kinder es zusammenfasste: «Eltern sind sozusagen der Boss von dir.»
Ein wichtiger sozialer Lebensort für Kinder ist die Schule. Diese nehmen sie nicht nur als Bildungsinstitution wahr. Schule bedeutet für sie ein Ort, wo man einander kennenlernt, «nicht zu viel streiten» soll und wo man sich zu «benehmen» lernt.
Wir alle sind betroffen
In Zeiten der Globalisierung können wir überall hinreisen, hinsehen und -hören. Wir können überall auf dieser Welt mitreden und -fühlen, wir können überall einkaufen, wellnessen und Geld verdienen. Wir können ausbeuten, vermarkten, Schnäppchen machen und Gewinnmargen extrapolieren.
Wir können überall auf der Welt Arbeit umverteilen, rationalisieren oder abschaffen. Aber falls wir das alles für positive Errungenschaften des Zusammenlebens und der Auseinandersetzung mit den anderen halten sollten, müssten wir wohl noch einmal über die Bücher gehen. Der Ubuntu-Leitsatz «Ich bin, weil wir sind» meint auf jeden Fall etwas ganz anderes.
In Zeiten von Corona stellt er viele Fragen an uns. Zum Beispiel: Wer ist wirklich betroffen? Die Antwort lautet: Wir alle und nicht nur die sogenannten Risikogruppen. Denn um die Pandemie zu überwinden, müssen wir uns alle ganz anders verhalten als gewohnt. Aus dem bisherigen Credo des «Höher, schneller, weiter» wurde in kürzester Zeit ihr Gegenteil: langsamer, kürzer, tiefgreifender, sorgfältiger, kleinteiliger.
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5»
Weitere Impressionen
Eine Rechnung, die nicht aufgeht
Zwei Drittel des Stimmvolkes wollten eine Kürzung. «Wir müssen deren Argumente aufnehmen und versuchen, auf sie einzugehen», weiss Antje Cubela. Das Hauptargument der Kürzungsbefürworter seien die Kosten, die vorläufig Aufgenommene generieren würden. Diese müssen gesenkt werden. Antje Cubela gibt zu bedenken: «Die Kürzung der Unterstützungsgelder beraubt diese Menschen der Möglichkeit, sich zu integrieren – und das kostet mittel- und langfristig erst recht.». So haben Untersuchungen des Bundes gezeigt, dass jeder Franken, der in die Integration investiert würde, später bis zu 4 Franken einspare. Moritz Wyder fügt hinzu, dass das Finanzierungssystem problematisch sei und überdacht gehöre: «Eine engagierte Gemeinde muss mehr bezahlen», dies sei nicht zwingend. Welchen Einfluss die Integrationsagenda 2019 auf die Situation haben wird, bleibt abzuwarten. Gewiss ist, dass der Verein map-F sich auch künftig stark machen wird für die Verbesserung der Lebensbedingungen von vorläufig aufgenommenen Menschen.
Inwiefern unterscheiden sich soziale Organisationen in diesem Punkt von anderen Organisationen?
Michael: Alle wissen besser, wie der Job zu machen wäre, aber niemand will es wirklich tun.
Christian: Im Sozialbereich gibt es fast immer eminent wichtige organisationsfremde Player, die eine Organisation fördern oder ihr in die Suppe spucken können. Damit umzugehen ist anders als in anderen Branchen.
Marianne: Manchmal fehlt es schlicht an Ressourcen. Manchmal an Innovationsgeist. Und darf man im sozialen Bereich wirklich erfolgreich sein?
Der Schlussbericht sowie die Kurzfassung davon finden sich auf der Website des BAG unter "Abgeschlossene Forschungsmandate": Tages- und Nachtstrukturen
Sicher und umsorgt
Trotz hoher Zufriedenheit mit sozialen Kontakten fällt auf, wie häufig sie über Negativerfahrungen berichten. So gab über die Hälfte der Kinder an, im vergangenen Monat von anderen Kindern beschimpft worden zu sein. Ein Drittel der 10- bis 12-Jährigen berichtete, von Gleichaltrigen geschlagen worden zu sein, und 40% wurden im letzten Monat bei sozialen Aktivitäten ausgeschlossen. Fast ein Viertel der Kinder stimmt sehr oder voll und ganz der Aussage zu, dass es viele Streitigkeiten in ihrer Klasse gibt.
Gleichzeitig berichtete die überwiegende Mehrheit (97,8%), vergangenen Monat von anderen etwas Nettes über sich gehört zu haben. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die meisten der befragten Schweizer Kinder sehr zufrieden sind. Die überwiegende Mehrheit fühlt sich sicher und zu Hause umsorgt, ist mit ihren Freundschaften glücklich und hat Menschen, die bei Problemen helfen.
Über Beziehungen nachdenken
Was wir in den vergangenen zwölf Monaten ebenfalls auf eindrückliche Weise gesehen haben: Die ausserordentliche Lage weckte die menschliche Solidarität – und trifft damit den Kern der Sozialen Arbeit. Diese hat den ureigenen Anspruch an sich selbst, dass niemand zurückgelassen wird. So lautet denn auch der zweite Teil des World-Social-Work-Day-Mottos passend «Strengthening Social Solidarity and Global Connectedness», die soziale Solidarität und die globale Verbundenheit stärken.
Soziale Arbeit basiert auf Resonanz, wie Hartmut Rosa es nennt, weil ihre Akteure in menschlichen Bezügen handeln und deshalb wissen, wo und wie ihre Tätigkeit in Beziehung steht und an welchen Beziehungen zu arbeiten ist. Der Anspruch der Sozialen Arbeit ist es nicht nur, diese Beziehungen in der Praxis anzuwenden, sondern sie auch in allen ihren Aspekten zu beleuchten und verstehen zu können.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Die ZHAW bietet Fachpersonen der Sozialen Arbeit neue Impulse für ihre Praxis. Im Rahmen von Vorträgen und Diskussionen erhalten Sie die Gelegenheit zum fachlichen Austausch.
Studierendenaustausch

Werkraum Projekte
Sommerfest des Departements
Website zur Vernetzung
Pflegekinder haben das Bedürfnis, sich mit anderen Pflegekindern auszutauschen. Zu diesem Zweck wurde in enger Zusammenarbeit mit der Begleitgruppe eine Website entwickelt. Diese Plattform ermöglicht es (ehemaligen) Pflege- und Heimkindern einerseits, sich zu vernetzen. Andererseits stellt sie (ehemals) fremduntergebrachten Jugendlichen und Erwachsenen sowie Fachpersonen Informationen zu aktuellen Projekten und Aktivitäten zur Verfügung. In der Rubrik «Einblicke» schildern Care Leaver ihre Erfahrungen.
Weitere Informationen

«Weltwirtschaft und Weltpolitik führen uns gerade vor Augen, wohin Autoritätsglaube und Unterordnung führen.»
Tagung zum Projekt
Die Tagung «Grenzüberschreitende Mobilität älterer Migrantinnen und Migranten: eine Herausforderung für die Soziale Arbeit?» findet am 30. Januar von 13.00 bis 16.45 Uhr statt. Die Teilnahme an der Tagung ist kostenlos. Anmeldeschluss ist Freitag, 10. Januar 2020.
Den Sorgen nachgehen
Einen zentralen Bezugsrahmen stellen für die befragten Kinder ihre Familie und Freunde dar. Situationen, in denen sie sich wohlfühlen, wurden fast ausschliesslich mit Erlebnissen mit Familie und Freunden gefüllt. «Die Familie kann man nicht im Shop kaufen, nicht so wie ein Spielzeug», sagte ein Kind und betonte: «Die Familie ist einmalig.» Wenig verwunderlich, dass auch Ängste und Sorgen mit deren Verlust oder Ärger verbunden und existenzieller Natur sind. So sagte ein Kind: «Ich mache mir Sorgen, dass ich plötzlich keine Freunde mehr habe, weil die mich hassen, oder dass ich plötzlich keine Familie mehr habe.»
Auch in der quantitativen Studie geben einige Kinder Anlass zur Sorge. Es sind wenige, aber ihre sehr negativen Bewertungen sind dafür umso bedenklicher. Wer sind diese Kinder? Was zeichnet ihre Lebenssituation aus? Wie können wir, fachlich und gesellschaftlich, ihren Bedarfen und Sorgen gerecht werden? Diese Fragen möchten wir weiterverfolgen.
Das Thema Agilität gewinnt zunehmend an Beachtung. Hype oder notwendige Entwicklung?
Marianne: Beides! Wenn eine Führungskraft eher rigide Verhaltensmuster zeigt, ist die Entwicklung von emotionaler Agilität natürlich sehr hilfreich und notwendig für Team und Organisation. Prozessorientierung (auch das meint ja Agilität) ist in der Organisationsberatung und in der Supervision schon länger ein Prinzip und eine Haltungsfrage. Ich bin überzeugt, dass wir aufgrund unserer Mehrperspektivität, wissenschaftlicher Rückbindung und Fachexpertise eben zwischen Hype und notwendiger Innovation unterscheiden können.
Christian: Genau, das sehe ich auch so. Wenn Sie eine bürokratische bzw. technokratische Organisation sind und realisieren, dass sich das Umfeld und die Ansprüche ändern und hierarchische Strukturen Ihre Performance bremsen, dann finden Sie Agilität interessant. Nun müssen Sie in erster Linie Ihre eigene Organisation sehr genau anschauen und verstehen, bevor es weitergeht. Wenn Sie das nicht tun, schaffen Sie den Entwicklungsschritt nicht. Ganz besonders dann nicht, wenn Sie ein hohes Kontrollbedürfnis haben.
Michael: Weltwirtschaft und Weltpolitik führen uns gerade vor Augen, wohin Autoritätsglaube und Unterordnung führen. Deshalb sollten wir im Kleinen alternative Zusammenarbeitsmodelle ausprobieren. Das tun wir gerade ganz bescheiden in unserem Institut.
Mehr zur Children’s Worlds
Kinder haben Rechte – so besagt es die UNO-Kinderrechtskonvention, die am 20. November 1989 verabschiedet wurde. Und wie steht es um ihre Erfahrungen, ihre Perspektiven und ihr Wohlbefinden? Das herauszufinden, ist das Ziel des internationalen Forschungsprojekts «Children’s Worlds». Die erste Erhebungswelle fand im Jahr 2010 statt. Das Institut für Kindheit, Jugend und Familie wurde im Rahmen der dritten Erhebungswelle beauftragt, mit der Teilstudie «Well-Being of Children in Switzerland» die erste Schweizer Teilstudie durchzuführen. Diese konnte mit der Unterstützung der Fondation Botnar und des Amtes für Jugend und Berufsberatung des Kanton Zürich im Jahr 2019 realisiert und in einem National Report ausgewertet werden.
An der Veranstaltung «Wie geht es Kindern in der Schweiz? Wohlbefinden, Lebensräume und Perspektiven» vom 3. November 2020 wurden die Resultate der Studie vorgestellt. Die Veranstaltung ist auf Video verfügbar.
Welche Rolle spielen in diesem Kontext Organisationsentwicklung und kultureller Wandel?
Marianne: Heterogenere Teams und komplexere Organisationen – das geht nur gut, wenn die Menschen in solchen Arbeitswelten über viel Selbststeuerung und Sozialkompetenzen verfügen, bzw. diese lernen können und sie organisational anerkannt sind. Und es braucht auch organisationales Wissen, z.B. zu strukturellen Konflikten sowie Rollenbewusstheit. Ansonsten werden alle Mücken zu Elefanten und es fehlt die Energie für die tatsächlichen Herausforderungen und Innovationen.
Michael: In den letzten Jahren wurde überreglementiert. Behörden und Kostenträger haben den leistungserbringenden Organisationen Qualitätsmanagement-, Kontroll- und Messsysteme aufgedrängt. Jetzt macht sich Ernüchterung breit. Fehler und Skandale geschehen immer noch, aber Regelwerke lernen nicht, sie übernehmen keine Verantwortung, sie sind nicht empathisch und sie haben keine innovativen Ideen. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie das Management einer Organisation die richtige Balance zwischen Strategie, Struktur und Kultur findet. Das ist in jeder Organisation anders und muss immer wieder neu justiert werden.

«Wir können belegen, dass professionell gerahmte Interventionen einen Unterschied machen, sowohl objektiv als auch subjektiv.»
Der Ruf nach Wirksamkeit wird immer lauter, wenn es darum geht, soziale Interventionen zu legitimieren. Lässt sich diese überhaupt belegen?
Michael: Der soziale Friede in der Schweiz ist ein Beleg dafür. Und selbstverständlich müssen soziale Organisationen Rechenschaft über ihre Tätigkeit ablegen. Allerdings ist es nicht immer einfach, einen direkten Zusammenhang von Ursache und Wirkung nachzuweisen. Das gilt auch für andere Bereiche, beispielsweise Polizei und Justiz. Nur sind die politisch weniger umstritten.
Christian: Wenn Wertvorstellungen sich mit dem Bedürfnis nach Vergleichbarkeit mischen, kommen Wirkungsmessungen dabei heraus.
Marianne: Die Frage hier ist ja immer, welche Belege denn zählen. Sind es objektivistisch-empirische Belege? Oder zählen auch subjektive Äusserungen von Beratungskundinnen und -kunden, die nach einem Führungscoaching oder einer Supervision gestärkter, klarer, handlungsfähiger in ihre Organisationen zurückkehren? Beide Perspektiven sind wichtig. Und wir bedienen mit unseren Dienstleistungen und Forschungen beide Perspektiven und können belegen, dass professionell gerahmte Interventionen einen Unterschied machen, sowohl objektiv als auch subjektiv.
Sie leiten das Institut für Sozialmanagement zurzeit interimistisch zu dritt. Wie sind Ihre Erfahrungen mit geteilter und kollegialer Führung?
Marianne: Abstimmungen sind natürlich aufwändiger, und dies strapaziert zuweilen völlig verständlich die Geduld unserer Mitarbeitenden. Zugleich sind Entscheidungen von uns als Co-Leitung differenzierter und ausgewogener, da wir jeweils unsere drei Perspektive einbringen. Wir sind unterschiedlich und wir schaffen es, dies als Ressource zu nutzen und uns nicht gegenseitig zu bekämpfen.
Michael: Kollegiale Führung bedeutet nicht weniger Führung. Für unsere Kolleginnen und Kollegen ist das nicht nur angenehm. In Hierarchien wird die Verantwortung nach oben delegiert. Wenn sie nun zurückkommt, kann sie einem auf die Zehen fallen. Darum ist unser Führungsmodell nicht schmerzfrei. Wir formulieren hohe Erwartungen in Sachen Selbstmanagement, laterale Führungskompetenzen, Selbstreflexionsvermögen und Konfliktfähigkeit – an die anderen wie auch an uns selbst.
Christian: Ich war geflasht als wir gemerkt haben, wie unterschiedlich wir drei ticken, aber dass wir in der Hinsicht die gleichen Grundüberzeugungen haben. Auch dass die Praxis- und Kundenorientierung das Nervenzentrum eines Instituts wie unserem sein muss oder wie wichtig es uns ist, verfestigte Auffassungen zu überwinden. Das passt alles. Damit hatten wir ein Grundvertrauen: Wir können uns aufeinander verlassen und wir wollen, obwohl es nur interimistisch ist, für und mit dem Team was erreichen – da kommt viel Energie zusammen.
Weitere Themen zum Institut für Sozialmanagement
Gründung eines Berufsvereins für Sozialarbeitende
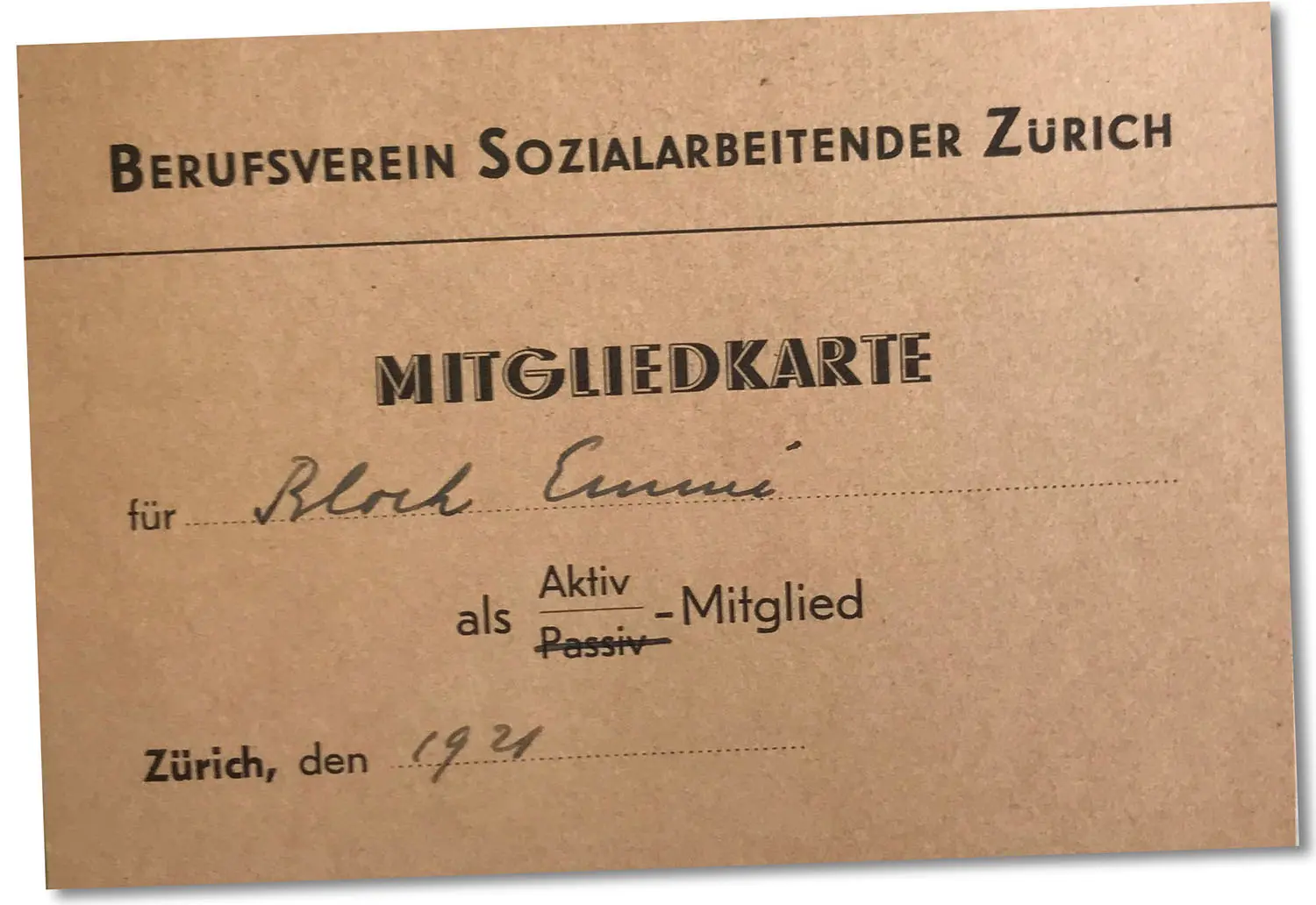
Emmi Bloch ist keine Strassenkämpferin, aber als ausgebildete Sozialarbeiterin kennt sie das Leben in den Strassen und Arbeiterwohnungen. Sie ist keine Sozialistin, aber sie liest sozialistische Schriften und beruft sich in der Frauenfrage auf August Bebel und Lily Braun. Sie ist keine Suffragette, aber sie kämpft als Publizistin, Funktionärin, Referentin und Dozentin ihr Leben lang für das Frauenstimmrecht und für die Berufsbildung von Frauen.
Sie tritt nie einer Partei bei, aber sie weiss um die politische Kraft von Organisationen und gründet zahlreiche: 1921 den Berufsverein für Sozialarbeitende Zürich – in der Schweiz der erste seiner Art – sowie 1923 die Schweizerische Zentralstelle für Frauenberufe, womit sie Zürichs erste Berufsberaterin für Mädchen und Frauen wird. Dazu kommt 1933 die Arbeitsgemeinschaft Frau und Demokratie als Reaktion auf die Machtergreifung der Nationalsozialisten in Deutschland.
Fort mit dem Korsett

Als mittlere von drei Töchtern wird sie 1887 in Zürich geboren. Die Familie hat eine Wäschefabrik im Industriequartier und führt einen bürgerlichen Haushalt mit Köchin und Dienstmädchen: Biedermeiermöbel, ein grosser alter Flügel, man musiziert und singt zusammen. Die Blochs pflegen zwar vorwiegend gesellschaftliche Beziehungen zur jüdischen Gemeinde, und die Mutter präsidiert den jüdischen Frauenverein, doch sie sind progressiv-liberal eingestellt. Emmi Bloch, die zeitlebens sehr gläubig ist, lehnt jede dogmatische konfessionelle Bindung ab und stellt sich zu einer reinen Gottesnähe, wie sie sie etwa bei Rilke fand.
In der Familie trägt sie den Spitznamen Eulenschwester, weil sie so belesen ist. Bei ihrem Tod im Jahr 1978 hinterlässt sie über 2000 Bücher. Als Kind schliesst sie sich manchmal zum Lesen in der Toilette ein. Eine scheue, aber wichtige Flucht aus dem «überflüssigen Conventionellen – in Mode und Wichtigerem» ist für sie die Jugendbewegung Wandervogel, damals in bürgerlichen Kreisen sehr populär. Man macht Ausflüge, kocht selbst, schreibt Gedichte. Nach der ersten Wandervogeltour legt Emmi Bloch das Korsett ab, für immer.
Kurs zur Einführung in weibliche Hilfstätigkeit
Alle drei Schwestern müssen für eine gewisse Zeit in der väterlichen Wäscherei arbeiten. Nach dem Besuch der Handelsabteilung an der Töchterschule und einer Ausbildung zur Weissnäherin ist Emmi Bloch drei Jahre lang in der Ferggerei tätig. Dort gibt sie Wäsche zur Heimarbeit aus und nimmt das Genähte wieder in Empfang. So kommt sie täglich in Kontakt mit Arbeiterinnen und sucht sie auch zu Hause auf, wenn diese krank sind.
Sie sieht die ökonomische Not der Familien. Der Wunsch nach einer sinnstiftenden sozialen Tätigkeit bewegt sie dazu, sich 1910 für den «Kurs zur Einführung in weibliche Hilfstätigkeit» anzumelden. Mentona Moser und Maria Fierz lancieren ihn 1908. Aus dem Kurs geht 1920 die Soziale Frauenschule hervor, heute das Departement Soziale Arbeit der ZHAW.
«Rationelle Betätigung» für Frauen
Die Fürsorgekurse sind die erste Ausbildungsgelegenheit in Sozialer Arbeit für Frauen in der Schweiz. Vorwiegend Töchtern aus begüterten Kreisen kommt hier eine frauenspezifische «soziale Erziehung» zuteil mit dem Ziel, soziale Ungerechtigkeit zu beheben – allerdings unentgeltlich. Zunächst geht es nicht um einen Beruf, sondern um das «Konzept gesellschaftlichen Handelns» und zu einer «rationellen Betätigung» der Frauen, wie Fierz 1912 im «Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Schulgesundheitspflege» schreibt.
Mit der Einführung des Zivilgesetzbuchs im selben Jahr werden dem Staat mehr Verpflichtungen in der Kinder- und Jugendfürsorge übertragen, als es in den kantonalen Gesetzen der Fall war. Relativ jung sind in Zürich auch die Amtsvormundschaft und das städtische Kinderfürsorgeamt. Ausgebildetes Personal ist immer gefragter, vor allem in stationären Einrichtungen.
Befreiung vom ehelichen «Parasitenleben»

Emmi Bloch zieht es jedoch zur offenen Fürsorge. Sie absolviert Kurs und Praktika mit Bestnoten und arbeitet dann sechs Jahre in der Tuberkulosefürsorgestelle. Dort ist sie sowohl im Innen- wie auch im Aussendienst tätig, macht Hausbesuche – jährlich bis zu 1200 – und hilft bei den ärztlichen Sprechstunden, erledigt Korrespondenz und Aktenführung. Ihr Jahresgehalt beträgt 2000 Franken. Bloch ist eine der ersten Sozialarbeiterinnen in der Schweiz, die entlöhnt werden.
Im Jahr 1916 beginnt sie als Leiterin in der Zürcher Frauenzentrale, der Dachorganisation der 14 Frauenvereine. Dort vermittelt sie Frauen Erwerbsmöglichkeiten, informiert über Hilfsangebote wie Kuraufenthalte und koordiniert diese. Es gibt auch Wärme- und Flickstuben sowie ein Mietzinsbüro, um zahlungsunfähig gewordene Mieterinnen zu unterstützen.
Mit dem Professionalisierungsschub wächst die öffentliche Anerkennung der Sozialen Arbeit. Frauen werden in Kommission entsandt und zu politischen Konferenzen eingeladen. Bloch nutzt solche Auftritte, um für die Berufsbildung von Frauen zu weibeln. Dass Frauen beruflich tätig sind, ist für sie ein gesellschaftlicher Auftrag, eine «Berufung zur Mitarbeit an den grossen Leistungen, die notwendig sind, dass die Gesamtheit leben kann», wie sie schreibt. Ausserdem sieht sie darin eine emanzipatorische Befähigung, sich von häuslicher Gewalt und einem «Parasitenleben ohne Ehre und Ehrlichkeit» zu lösen.
Fürs Frauenstimmrecht
Bloch ist Mitglied des Zürcherischen Stimmrechtsvereins, ab 1917 engagiert sie sich öffentlich für das Frauenstimmrecht. Sie publiziert vorwiegend in der «Neuen Zürcher Zeitung», in der «National-Zeitung» und natürlich im «Schweizer Frauenblatt», dessen Chefredaktorin sie zwischen 1933 und 1943 ist. Zudem unterrichtet sie während fast drei Jahrzehnten das Fach Frauenfragen, unter anderem an der Sozialen Frauenschule und an der Volkshochschule.
Die Fürsorgearbeit zeigt der Sozialreformerin die Notwendigkeit des Stimmrechts als Arbeitsmittel auf: Über zu sprechende Gelder und Konzessionen wird in Sitzungen gesprochen, ohne dass Frauen anwesend sind und über den Verwendungszweck der Gelder Auskunft geben können. Doch sie ist zuversichtlich, 1919 schreibt sie: «Die Zeit des Frauenstimmrechts ist gekommen. Ihm wird sich auch die Schweiz nicht verschliessen können.» Die Schweizer Männer sehen das anders, noch weitere 52 Jahre lang.
Gesundheitlich angeschlagen
Bei allem Engagement ist Bloch eine typische Vertreterin der bürgerlichen Frauenbewegung. Sie will nicht konfrontieren, sondern vermitteln. Sie zementiert die weibliche Doppelbelastung, indem sie für eine zweifache Berufsbildung plädiert, sowohl in Hauswirtschaft wie auch für eine Erwerbstätigkeit. Wie das zu schaffen sei, wird sie sogar von Männerseite kritisiert. Sie bleibt die Antwort schuldig – oder gibt sie indirekt mit ihrem eigenen Beispiel: der totalen Hingabe an die Berufung.
Diese Hingabe erfüllt sie, erschöpft sie aber auch. Schon als junge Frau leidet sie oft unter gesundheitlichen Problemen, Bronchialkatarrh, Angina, Überanstrengung. Sie muss häufig pausieren und zur Kur fahren. Bei einem Wandervogel-Ausflug 1916 im Wallis verletzt sie sich und erleidet einen Schock. Körperliche Schäden bleiben keine zurück, psychische möglicherweise schon, zum Beispiel leidet sie zunehmend unter Platzangst. Ausserdem setzen ihr immer wieder antisemitische Anfeindungen zu.
Kosmische Aufgabe zur Mutterschaft
Emmi Bloch hofft, das mütterliche Potenzial von Frauen in politische Macht umwandeln zu können. So fördert sie jene Berufe, die ihrer Ansicht nach mit Mütterlichkeit verbunden sind, also keine Handelsberufe. Die Hausfrauenarbeit und «die kosmische Aufgabe zur Mutterschaft» versteht sie als «ureigenste Frauenarbeit».
Bei Bloch findet selbst Mutterschaft in «geistig-seelischen Bezirken» statt: Sie bleibt unverheiratet, hat keine Kinder. Bis im Alter von 42 Jahren lebt sie bei ihren Eltern, dann nimmt sie mit einer Freundin, der Sozialarbeiterin und Berufsberaterin Anna Mürset, eine Wohnung. 1944, nach ihrer frühzeitigen Pensionierung, zieht sie in ein Haus nach Uerikon am Zürichsee und lebt dort bis zu ihrem Tod 1978 mit einem Dienstmädchen.
Bloch pflegt viele und enge Freundschaften, mit Männern wie auch mit Frauen. Warum kommt es nie zu einer offiziellen Beziehung oder gar Ehe? Wir wissen es nicht. Stets trennt sie Privates und Berufliches und verfügt, dass alle Tagebücher nach ihrem Ableben verbrannt würden. Mit einer Ausnahme hält sich Emmi Blochs Neffe und Nachlassverwalter daran.
Veranstaltung «100 Jahre organisierte Soziale Arbeit in Zürich»
Was mit fürsorgerischen Massnahmen zur Armutsbekämpfung begann, ist heute eine methodisch und theoretisch fundierte Profession mit Hochschulausbildung. Massgeblich für die Entwicklung der Sozialen Arbeit war, dass sich die Fürsorgestellen organisierten und zusammenschlossen. Einer dieser Verbunde war der im Jahr 1921 von Emmi Bloch gegründete Zürcherische Berufsverein Sozialarbeitender.
Die Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe «Um 6 im Kreis 5» würdigt 100 Jahre Berufsverband und Professionsentwicklung sowie den gesellschaftlich-politischen Wahrnehmungswandel der Sozialen Arbeit.
Themen mit hoher Aktualität vertiefen
Die Thematik der Fremdplatzierung junger Menschen ist gesellschaftspolitisch sehr aktuell. Das Projekt WiF schafft verschiedene Angebote für den interdisziplinären Austausch zwischen Fachpersonen aus Praxis und Forschung. Gemeinsam werden in einer dialogischen Wissensentwicklung empirische sowie handlungsbezogene Wissensbestände vertieft, verknüpft und weiterentwickelt – zum Beispiel in Umfragen, Workshops oder Tagungen. So will WiF fortwährend ein gemeinsames Verständnis darüber vertiefen, was sich in Praxis und Wissenschaft als wirksam, hinderlich oder als irritierend zeigt. Die gewonnenen Erkenntnisse werden kontinuierlich für die Online-Plattform ausgearbeitet. So will WiF.swiss sich langfristig zu einer lebendigen Wissensbasis für Fremdplatzierungen entwickeln.
Zuerst Fieber messen
Seither steht der Treffpunkt City ausschliesslich obdachlosen Menschen offen. Wir können ihnen jetzt nur Leistungen der Überlebenshilfe anbieten, die es auch schon vorher gab. Das heisst, man bekommt bei uns weiterhin jeden Tag am Mittag gratis eine Suppe sowie alkoholfreie Getränke. An kälteren Tagen kann man sich tagsüber drinnen aufwärmen. Es gibt eine Dusche und eine Waschmaschine, die Leute können Zeitungen lesen, spielen, sich unterhalten fernsehen und einen Computer mit Internetzugang nutzen. Ausserdem bieten wir durch das Fachteam Beratung für jene Klientinnen und Klienten, die den Treffpunkt im Moment nicht nutzen können, weiterhin niederschwellige Beratungsmöglichkeiten an, zurzeit telefonisch.
Das Kochen und das Putzen übernehmen jetzt die städtische Arbeitsintegration und das Personal. Insgesamt sind sieben Sozialarbeitende für den Treffpunkt City angestellt. Gleichzeitig vor Ort sind sonst drei bis vier, derzeit sind wir höchstens zu zweit. Wir müssen uns streng an die Massnahmen zum Schutz vor COVID-19 halten. Die Mitarbeitenden tragen Masken. Es hat Desinfektionsmittel, und wir erinnern alle daran, sich die Hände zu waschen und zwei Meter Mindestabstand einzuhalten. Bei allen messen wir zuerst die Körpertemperatur. Wer über 38 Grad hat, darf nicht ins Haus kommen. Wir empfehlen dann, einen Arzt zu kontaktieren.
Mehr «menschliche Substanz»
Wir treffen uns an einem sonnigen späten Nachmittag bei der Kollerwiese in Zürich-Wiedikon. Im Gras sitzen Menschen auf Abstand in kleinen Gruppen beisammen, auf dem Spielplatz klappt das mit dem Physical Distancing hingegen noch nicht so richtig. Die 32-jährige Zürcherin ist Teilzeitstudentin im ersten Bachelor-Semester. Daneben arbeitet sie im Hort 15plusSHS, einem Angebot der Stadt Zürich, das Jugendliche mit unterschiedlichen Beeinträchtigungen für die Berufswahl vorbereitet.
Stefanie Pfrunder hat bereits einen Master in Pflanzenphysiologie der Universität Zürich. «Ich habe mich stets in Vereinen und Gruppen engagiert, aber lange nicht daran gedacht, dass das ein Beruf sein könnte.» Nach einer anderthalbjährigen Velotour und einem Brotjob als Verpackerin bei einem Lebensmittel-Onlinehändler reifte in ihr die Gewissheit, dass ihr beim ursprünglichen beruflichen Weg die menschliche Substanz fehlte, wie sie es nennt. So entschloss sie sich für das Studium Soziale Arbeit an der ZHAW und bewarb sich bei der Stadt Zürich.
Stellensuchende müssen sich qualifizieren
Seit drei Jahren leitet sie die Abteilung, die arbeitsmarktliche Massnahmen für die Stellensuchenden der RAV im Kanton St. Gallen bereitstellt. Diese Massnahmen bestehen zum einen aus Kursen, die auf die Qualifizierung der Stellensuchenden abzielen, und zum anderen aus zeitlich begrenzten Beschäftigungsprogrammen, bei welchen allerdings auch ein qualifizierender Teil enthalten ist. Die Tendenz gehe Richtung Qualifizierung der Stellensuchenden, sagt Pagelli.
Die 50-Jährige ist strategisch, fachlich und personell für die Abteilung verantwortlich. Diese ist für Bildungs- und Beschäftigungsangebote zuständig sowie für Massnahmen, die den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt konkret unterstützen. Welche Kurse und Programme sind für welche Zielgruppe geeignet? Wie viele verschiedene Massnahmen sollen angeboten werden? Das sind – zusammen mit der Finanzierung – die grundsätzlichen Fragen, mit denen sich ihre Abteilung beschäftigt. Diese zählt mit den Mitarbeitenden der angegliederten RAV in den Regionen knapp 50 Personen.
Studienreisen und Auslandsemester
Die Ausbildung Soziale Arbeit ist herausgefordert: Welchen Beitrag kann sie leisten, um zukünftige Praktikerinnen und Praktiker auf die Tätigkeit in wachsenden multikulturellen Feldern vorzubereiten? Wie kann sie die «Employability» unterstützen, das heisst, die Arbeitsfähigkeit, welche die Brücke bildet zwischen den allgemeinen Anforderungen der Arbeitswelt und den fachlichen, methodischen sowie sozialen Kompetenzen der Studierenden?
Am Departement Soziale Arbeit der ZHAW haben sich in den letzten Jahren einige Lehrveranstaltungen mit internationaler und transkultureller Ausrichtung etablieren können. Die Studierenden können heute auf ein Angebot fremdsprachiger Seminare, interprofessioneller und -kultureller Kurse sowie kürzerer und längerer Studienreisen zurückgreifen. Dieses Angebot ist curricular verankert, ist also anrechenbar am regulären Studium. Auch nutzen jedes Semester Studierende die Möglichkeit, an einem Auslandssemester oder -praktikum teilzunehmen.
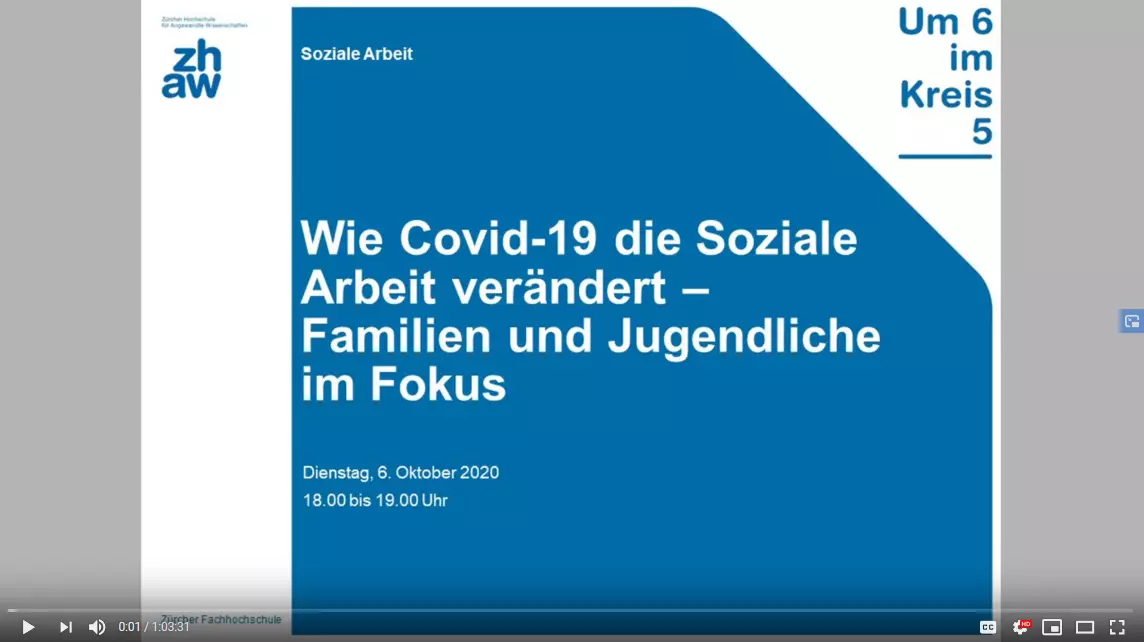
«Den Finger auf den wunden Punkt legen»: Zwei Referate stossen den Dialog an
Nach der einleitenden Heranführung durch Stefan Eberitzsch (Institut für Kindheit, Jugend und Familie, ZHAW) und Gabriele E. Rauser (Geschäftsführerin Integras) sowie Thomas Gabriel (Leiter Institut für Kindheit, Jugend und Familie, ZHAW) warfen die Referierenden Basil Rogger und Annegret Wigger grundsätzliche und kritische Fragen zur Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Fremdplatzierungspraxis auf. Die Tagungsteilnehmenden hatten nach jedem Referat die Möglichkeit, in sogenannten «Murmelgruppen» kurz auf das Gesagte zu reagieren und die Punkte, die für die Praxis wichtig erschienen, festzuhalten. Im Anschluss hatten die Teilnehmenden Gelegenheit, das Projekt WiF und die Online-Plattform WiF.swiss besser kennenzulernen und auch erste Bewertungen und Beiträge einzubringen.

«Der Bundesrat forderte die Menschen auf, zu Hause zu bleiben – aber wie macht man das, wenn man kein festes Obdach hat?»
Flurin Müller, Student ZHAW Soziale Arbeit
Intensive Gespräche
Pfrunder bekommt für ihren Freiwilligeneinsatz Credit Points. Indem die ZHAW Soziale Arbeit den Einsatz anrechnet, will das Departement in der Corona-Krise Organisationen des Sozialwesens entlasten. Rund 40 Studierende haben sich dafür gemeldet. «Ich freue mich natürlich über die Punkte, aber ich wäre auch sonst aktiv geworden», ist Stefanie Pfrunder überzeugt.
Laufbahn mit Brüchen
Maja Pagellis Laufbahn war keine klassische. «Es gab viele Brüche», findet sie. Begonnen hat sie ihr Berufsleben als Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin im Toggenburg. Nach einigen Jahren hatte sie sich gefragt: «Will ich das bis zur Pensionierung machen?» Nein, entschied sie. Sie holte die Matura nach und begann ein Studium der Politikwissenschaft an der Universität Zürich. Doch nach zwei Semestern kam sie zur Erkenntnis: Wenn ich damit fertig bin, fange ich beruflich wieder ganz unten an.
Dank ihren Fähigkeiten als Handarbeitslehrerin fand sie eine Stelle bei der Arbeitsintegration. Sie wurde Kursleiterin in einem Textilatelier und schulte Stellensuchende mit der Zeit auch zu Bewerbungsfragen. Dann gab sie beim Kanton St. Gallen Bildungs- und Coaching-Kurse, dies in einem Bereich, der ihr jetzt unterstellt ist. Nach einem Wechsel an die Berufsbildung in Zürich wurde ihr angeboten, den Bereich Bildungsangebote des Kantons St. Gallen zu leiten. Das machte sie etwa sieben Jahre lang. In dieser Zeit absolvierte sie auch den MAS Berufs- und Erwachsenenbildung, bis sie vor drei Jahren schliesslich die Leitung der ganzen Abteilung übernahm.
Engagement wird anerkannt

Im Zentrum dieser Internationalisierungsbemühungen stehen vor allem drei Ziele. Erstens die Vermittlung (inter-)kultureller Kompetenz als Schlüsselqualifikation Sozialer Arbeit. Als zweites sollen Fremdheitserfahrung in anderen kulturellen Systemen und die Erweiterung des Wahrnehmungs- und Handlungsspektrums ermöglicht werden. Und drittens vermittelt ein Studium an der ZHAW Wissen über Globalisierungsprozesse und deren Auswirkungen auf die Soziale Arbeit.
Während einige Hochschulen wie die deutsche FH Bielefeld Studienschwerpunkte zum Thema «Global Social Work» entwickelt haben, bleibt unsere Ausbildung an der ZHAW generalistisch. Wer aber einen Fokus auf Internationalität und Transkulturalität setzen möchte, kann ab diesem Herbstsemester ein Certificate International Profile (CIP) erwerben. Es handelt sich um ein Zusatzzertifikat, das künftigen Arbeitgebenden Schlüsselqualifikationen ausweist, welche die Studierenden aus der Erarbeitung sprachlicher und interkultureller Kompetenzen sowie internationaler Erfahrungen erworben haben.
Darin werden auch sogenannte extracurriculare Leistungen anerkannt. Wer sich also in sozialarbeiterisch relevanten Feldern ausserhalb der regulären Ausbildung engagiert, kann sich dies ab diesem Semester anerkennen lassen und erhält mit dem CIP am Ende des Studiums einen Ausweis darüber.
Interessiert an weiteren Fachveranstaltungen?
Vertiefte Auseinandersetzung in Workshops und Podiumsdiskussion
In fünf thematischen Workshops sowie in einer Podiumsdiskussion konnten die Teilnehmenden dann ihre konkreten fachlichen Perspektiven, Erfahrungen und Fragen einbringen und ausgiebig diskutieren. Mit der Tagung wurde der Grundstein gelegt für einen langfristigen Austausch. Das Projekt WiF hat gerade erst begonnen: In kommenden Workshops, Tagungen und vor allem über die Online-Plattform wird Fachwissen über Platzierungsprozesse niederschwellig zugänglich gemacht und weiterentwickelt, Orientierungen werden ausdifferenziert und Reflexionen zu bestehenden Haltungen unterstützt.
Telefonisch in Kontakt bleiben
Derzeit können 80 Prozent unserer Klienten nicht mehr in den Treffpunkt City kommen. Vielen bricht dadurch die Tagesstruktur weg. Für uns stellt sich die Herausforderung, wie wir trotzdem mit den Menschen in Kontakt bleiben und die wichtige Beziehungsarbeit fortführen können. Ungefähr einmal pro Woche rufen wir unsere Stammklientel an, die wir sonst täglich sehen. Viele rufen uns auch von sich aus an.
Essen und Beratungen bekommen Obdachlose aus der Stadt Zürich auch weiterhin bei anderen Organisationen wie etwa dem Café Yucca, aber einige Angebote, unter anderem wo sie duschen oder waschen können, sind aufgrund des Lockdowns geschlossen, zum Beispiel der Treffpunkt t-talk.
Viele unserer Klientinnen und Klienten haben Vorerkrankungen und gehören zur Risikogruppe. Oftmals haben sie keinen guten allgemeinen gesundheitlichen Zustand. Sie haben Respekt vor der Krankheit, und es kursieren auch immer einmal wieder Verschwörungstheorien – so wie in der restlichen Bevölkerung auch.
Es sind natürlich besondere Umstände, unter denen ich meine siebenmonatige Praxisausbildung mache. Sie ist ein wichtiger Bestandteil meines Bachelorstudiums. Neben der Arbeit im Treffpunkt gehören ein Vertiefungsmodul, ein Seminar und eine Supervision dazu. Das lässt sich gut organisieren, mit dem vermehrten Online-Unterricht sowieso. Aber den ganzen Tag eine Maske tragen zu müssen, immer Abstand zu halten und Nähe übers Telefon herzustellen, das alles vereinfacht die Arbeit nicht gerade. Allerdings lerne ich dadurch etwas, das ich sonst nicht so schnell gelernt hätte.
«Ich wünsche mir soziale Plattformen, auf denen man nicht nur Gegenstände, sondern auch Wissen, Talent, Fähigkeiten teilt.»
Stefanie Pfrunder, Bachelorstudentin
Bootcamp für die Stellensuche
Maja Pagelli schätzt den Gestaltungsspielraum, den sie mit ihrem Team hat, ebenso die Vielseitigkeit sowie die Chance, sich immer weiterentwickeln zu können. Gerade erst hat sie in einem Pilotprojekt ein so genanntes Bootcamp für Stellensuchende entwickelt, das diesen Frühling hätte lanciert werden sollen. Es basiert auf einer Idee von Studenten der Wirtschaftsinformatik der Uni St. Gallen: Sie sollten aufzeigen, wie neue Arbeitsformen der Arbeitswelt 4.0 in Angebote einfliessen könnten – unkonventionell und ohne Scheuklappen. Daraus entstand dieses Bootcamp, eine Schulungswoche rund um die Stellensuche, an deren Ende ein Speed Dating mit potenziellen Arbeitgebern steht.
Internationalisierung vor der eigenen Haustür
Das Departement Soziale Arbeit möchte damit auch die Internationalisierung von Studierenden ermöglichen, die aufgrund finanzieller Gründe oder sozialer Verpflichtungen keine Möglichkeit haben, für ein Studiensemester oder Praktikum ins Ausland zu gehen. «Internationalisation@home» ist ein Konzept, welches bereits länger im internationalen Hochschuldiskurs behandelt wird und dessen Dringlichkeit sich zuletzt durch die Corona-Krise offenbart hat.
Das CIP ist ein möglicher Zugang zu diesem Konzept: Es eröffnet nicht nur Raum für Chancengleichheit, sondern auch für Themen der Nachhaltigkeit. Denn – das haben die vergangenen Monate gezeigt – «Internationalisierung» entsteht nicht ausschliesslich durch Mobilität, sondern auch durch die interkulturelle Auseinandersetzung mit verschiedenen Anspruchsgruppen vor der eigenen Haustür.
Newsletter abonnieren
Möchten Sie über aktuelle Veranstaltungen, praxisrelevante Themen, neueste Forschungsergebnisse und Ihre Weiterbildungsmöglichkeiten informiert sein? Dann abonnieren Sie den Newsletter der ZHAW Soziale Arbeit. Er erscheint sechs bis acht Mal jährlich.
Präsentationen zum Download
- Leitideen der Fremdplatzierung – Eine Geschichte zwischen Hilfe, Kontrolle und Selbstbestimmung (PDF 178 kB) Prof. Dr. Annegret Wigger, Dozentin, Institut für Soziale Arbeit, Fachhochschule St. Gallen
- «Den Finger auf den wunden Punkt legen » – Fremdplatzierung und Kritik daran aus Betroffenensicht (PDF 1.36 MB) Basil Rogger, Ko-Initiant der Ausstellung «Enfances volées – Verdingkinder reden»
Obdach und Essen trotz Corona-Krise
Der Geschäftsbereich Schutz und Prävention der Sozialen Einrichtungen und Betriebe der Stadt Zürich führt drei Treffpunkte, in denen randständige Menschen aus der Stadt Zürich die Möglichkeit bekommen, sich zu stabilisieren und ihren Alltag zu strukturieren. Das mobile Angebot «Ein Bus» betreibt nach wie vor aufsuchende Sozialarbeit, und der Treffpunkt City im Zürcher Seefeld ist weiterhin geöffnet. Der Treffpunkt t-alk in Zürich-Enge ist vorübergehend geschlossen.
Die Notschlafstelle und die Nachtpension haben auf 24-Stunden-Betrieb umgestellt. So können die Bewohner diese auch tagsüber nutzen. Auf dem Strichplatz, der auf Anordnung des Bundes vorübergehend geschlossen wurde, betreibt das Sozialdepartement nun für schwerstabhängige Menschen im Rahmen einer Notlösung weiterhin eine Kontakt- und Anlaufstelle (Temporäre K&A Depotweg). Hier ist ein überwachter Konsum mit Abstand möglich. Hilfesuchende, die nicht aus der Stadt Zürich kommen, können sich an die Zentrale Abklärungs- und Vermittlungsstelle wenden.
Anfangs wurde das Netzwerk im Kreis 9 nicht gerade überflutet mit Anfragen, erzählt sie. «Aber es geht im Grunde nicht um die Menge, sondern um die Qualität. Die Gespräche waren intensiv, und die Menschen freuten sich alleine schon darüber, mit jemandem reden zu können.» Negative Erfahrungen haben sie fast keine gemacht. Nur einmal regte sich jemand auf, einen Flyer im Briefkasten zu finden. Auch zu Betrugsfällen kam es nicht – trotz der Anonymität in der Gruppe. «Wir haben eine Datenschutzerklärung eingebaut, die einen zu den einzelnen Personen zurückführen würde», sagt Pfrunder, «und bei neuen Kontakten, die ich vermittelt hatte, rief ich anfangs im Anschluss noch einmal an und um sicher zu gehen, dass alles gut abgelaufen ist.»
Mit neuen Ansätzen experimentieren
Mehrere Unternehmen konnten dafür schon gewonnen werden. Die Arbeitswelt 4.0 und die digitale Transformation beschäftigt Pagelli in der Ausgestaltung der Angebote – und auch in der eigenen Abteilung. Wie verändert sich die Arbeitswelt? Wie gehen wir mit diesen Veränderungen um, und welchen Einfluss haben sie auf die Stellensuchenden? «Viele Begrifflichkeiten schwirren umher», sagt Pagelli. Diese zu verstehen, sich mit Themen auseinanderzusetzen, die im Arbeitsalltag keinen Platz haben: Das waren wichtige Gründe, warum Pagelli sich zur Teilnahme am CAS «Culture Change – Mindset für neue Arbeitswelten» der ZHAW entschieden hat.
Gereizt habe sie zudem die Vielfalt an Themen und dass der CAS zum ersten Mal stattfand: «Ich wollte etwas Neues miterleben, denn so geht es uns ja auch, wenn wir neue Angebote kreieren.» Wie würde ich es machen, wenn ich alle Optionen offen hätte? Dieser Ansatz faszinierte Pagelli, so einfach er zunächst auch klinge, sagt sie. Bei der Lösungssuche gehe darum, sich in die Rolle und die Funktion des Gegenübers zu versetzen, die Welt mit seinen Augen zu betrachten und dabei die eigene Rolle zu überprüfen und auch die Haltung und Einstellung zur digitalen Arbeitswelt zu hinterfragen. Für ihre Tätigkeit schliesst sie daraus: «Wir müssen uns noch mehr auf den Markt und den Kunden ausrichten.»
Wie es weitergehen soll
Mittlerweile sind die Anfragen deutlich zurückgegangen, und die meisten aus dem Helfernetz sind wieder stärker in ihren eigenen Alltag eingebunden und nicht mehr so flexibel verfügbar. Das Projekt wird aber nicht beendet, sondern befindet sich in einer Transformationsphase. Eine Kerngruppe von 32 Teilnehmenden hat sich gebildet. Zum einen wollen sie den Namen ändern, weil es bereits einen Verein mit dem fast identischen Namen «Nachbarschaftshilfe» gibt und dieser auch im Kreis 9 präsent ist. Zum anderen will man nun per Umfrage und Diskussion herausfinden, wie es inhaltlich weitergehen soll.
Die bisherige Resonanz zeigt, dass viele Gedanken in Richtung Sharing-Plattform und Stärkung des Gemeinschaftslebens gehen: Reparatur-Werkstätten, Cafés, Koch- und Tanzabende. Wichtig ist Pfrunder, dass keine Doppelspurigkeiten entstehen. «Wir sind darum im engen Austausch mit den etablierten Einrichtungen im Quartier, mit den Gemeinschaftszentren und anderen», betont sie.
Was wünscht sie sich, mit dieser Initiative auszulösen? Sie muss nicht lange überlegen: «Mehr persönliche Begegnungen im Quartier und die unentgeltliche Nutzung vorhandener Ressourcen. «Auf der Plattform oder den Plattformen, die ich mir erhoffe, teilt man nicht nur Gegenstände, sondern auch Wissen, Talent, Fähigkeiten.» Als nächstes hofft Stefanie Pfrunder, dass sich die Lage beruhigt, damit sie mit allen Beteiligten im Sommer ein Fest feiern kann, sowohl mit Helfenden wie auch mit Nutzniessenden – eine weitere Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken.
CAS Culture Change – Mindset für neue Arbeitswelten
Der CAS «Culture Change – Mindset für neue Arbeitswelten» richtet sich an Personen aus allen Branchen und in allen Funktionen, die den digitalen Wandel in der Arbeitswelt aktiv mitgestalten wollen.
Die neunmonatige Weiterbildung ist eine Kooperation des Departements Soziale Arbeit (Institut für Sozialmanagement), der ZHAW School of Management and Law (Zentrum für Unternehmensentwicklung) sowie der Zürcher Hochschule der Künste ZHdK (Departement Design und Zentrum Weiterbildung). Der nächste Lehrgang startet am 17. Oktober 2020.
CAS Culture Change – Mindset für neue Arbeitswelten
Weitere Informationen
Start an der ZHAW im Ressort Internationales
Nach zwei Jahren kehrte er in die Schweiz zurück und startete im November 2007 seine Karriere an der ZHAW als Stabsstellenleiter im Ressort Internationales der ZHAW. Heute, gut zwölf Jahre später, ist Wittmann zum Direktor des Departementes Soziale Arbeit ernannt worden. Dieses hatte er bereits ein Jahr lang interimistisch geleitet.
Mittlerweile identifiziert er sich ganz mit seiner Funktion als Führungskraft und Manager. Den internationalen, vergleichenden Blick hat er sich aber bewahrt. Ebenso den Wunsch, Grenzen zu überwinden und das Gemeinsame zu suchen – «sei es kulturell, disziplinär oder über Hierarchien hinweg», sagt er.
Vor einem Jahr habe er noch gedacht, er kenne das Departement wie seine Westentasche. Und dann habe er im Interimsjahr doch viel Neues gelernt und kennengelernt. Das motiviert ihn: dass jede neue Funktion mit einem grossen Entwicklungspotenzial einhergeht. Es war zwar ein Übergangsjahr, aber lediglich das Tagesgeschäft aufrechterhalten, das wollte er unter keinen Umständen. «New Beginning» nannte er deshalb das Programm, das er im Juni 2019 startete. Nun als Direktor habe er zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Diese möchte er nutzen, damit das Departement durch interdisziplinäre Herangehensweisen und innovative Themenkombinationen neue Angebote in analogen und digitalen Formaten entwickelt.
International und praxisnah
Das Departement habe Energie und Kontur, doch für grosse Praxisnähe stehe es nicht, stellt Wittmann fest. Das will er ändern: Er will näher an die relevanten Fragestellungen der Sozialen Arbeit und des gesellschaftlichen Wandels gelangen und eng mit den Akteuren in Verwaltung und Praxis zusammenarbeiten: «Wir müssen Praxis und Wissenschaftsorientierung miteinander verbinden und in eine Balance bringen.»
Er möchte Themen wie Sozialhilfe, Arbeitsintegration, Erwachsenenschutz und Behinderung stärken, ohne bisherige Schwerpunkte des Departementes beispielsweise in der Kinder- und Jugendhilfe oder im Straf- und Massnahmenvollzug zu vernachlässigen. Und auch beim Thema Digitalisierung müsse sich die Soziale Arbeit mit den tiefgreifenden Veränderungen in der Gesellschaft beschäftigen: mit der sozialen Ungleichheit durch Prozesse der Digitalisierung oder mit der Kriminalität im virtuellen Raum. Das betrifft sowohl die Aus- und Weiterbildung wie auch die Forschung, betont Wittmann. Gerade erst hat er einen Data Scientist eingestellt: Der ETH-Physiker mit langjähriger Industrieerfahrung wird technologische Expertise und Erfahrung in Innovationsprozessen einbringen. «In Kombination mit unserem sozialarbeiterischen Know-how wird das ein spannendes Experiment», ist Wittmann überzeugt.
Schlichten, moderieren, vernetzen
Ob er als Führungskraft manchmal kritisiert wird? «Natürlich», sagt er lachend. Doch die Einsamkeit der Führungspersonen, wie sie in der Managementliteratur oft beschrieben wird, kennt Wittmann nicht: «Die Soziale Arbeit ist ein kritisch-reflexiver Beruf, dementsprechend sind die Fachpersonen selbstbewusst und kommunizieren offen. Daraus ergeben sich viele wertvolle Beziehungen.» Konstruktive Kritik mache Entscheide am Ende besser, ist er überzeugt.
Zum Kern einer Führungsfunktion gehöre es, Prozesse so umsichtig zu gestalten, dass am Ende zukunftsgerichtete und tragfähige Entscheidungen stehen. Das ist im Hochschulumfeld nicht immer ganz einfach, der Umgang mit den heterogenen Erwartungen ist herausfordernd. Er will die Mitarbeitenden mehrheitlich mitnehmen und sieht dennoch, dass er es nicht allen recht machen kann: «Schlichten, moderieren, vernetzen – das ist emotional anspruchsvoll.» Die Energie, die am Departement herrsche, könne sich konstruktiv entladen, aber wenn unterschiedliche Ziele und Interessen aufeinanderprallen, «da kann es schon einmal krachen».
Gut 25 Prozent seiner Arbeitszeit will Frank Wittmann wie bis anhin in der Weiterbildung tätig sein, «um die Füsse auf dem Boden zu behalten», wie er sagt. In seinem neuen CAS Culture Change geht es um die Frage, wie man Organisationskulturen weiterentwickeln kann. Der direkte Austausch mit den Teilnehmenden ermögliche ihm einen direkten Zugang zum Feld. «Dies ist eine Gelegenheit, wieder einmal meinen ethnologischen Blick zum Tragen kommen zu lassen», meint der neue Direktor.
Frank Wittmann
Der Zürcher Fachhochschulrat hat den 46-jährigen Frank Wittmann auf den 1. Juni 2020 zum offiziellen Direktor des Departements Soziale Arbeit ernannt. An der ZHAW ist der promovierte Sozialwissenschaftler bereits seit Ende 2007 tätig: Als Stabsstellenleiter im Ressort Internationales trug er zur Positionierung der ZHAW im internationalen Umfeld bei. Im Herbst 2012 wechselte er ans Departement Soziale Arbeit und wurde Leiter Weiterbildung und Dienstleistung. Nach drei Jahren übernahm er die Leitung des neu gegründeten Instituts für Sozialmanagement, welches er aufbaute und etablierte, bis er im Juni 2019 zum interimistischen Direktor ernannt wurde. Wittmann hat an der Universität Fribourg promoviert, in Westafrika ethnografische Feldforschung durchgeführt und sich in der Friedensförderung bei der Uno engagiert. Zurzeit absolviert er eine Online-Weiterbildung der Stanford University in Innovationsmanagement und Unternehmertum. Er lebt mit seiner Familie in Zürich.
Ihre Anonymität ist gesichert
Ihre persönlichen Angaben werden anonym und streng vertraulich behandelt und nicht an Dritte wie weitere Teilnehmende an der Studie, Institutionen, Behörden oder Medien weitergegeben.
Kontakt
Haben Sie Interesse oder weitere Fragen? Dann melden Sie sich bei uns.
Oder über folgende Telefonnummern:
058 934 88 64
078 771 47 47
Weitere Informationen
von Regula Freuler
Seit die ZHAW den Präsenzunterricht vor etwas mehr als drei Wochen eingestellt hat, läuft der Unterricht in digitalen Hörsälen ab. Statt also am Morgen mit dem Tram ins Toni-Areal zu fahren, klappen die Studentinnen Marion Caspar und Sara Steiner zu Hause ihre Laptops auf und loggen sich in ihre jeweiligen Vorlesungen ein. «Es war gewöhnungsbedürftig, aber die Dozierenden haben viel in die Umstellung ihres Unterrichts investiert und uns in jeder Hinsicht sehr unterstützt», sagt die 27-jährige Sara Steiner. Natürlich habe es zu Beginn ab und zu geholpert. Einmal wurde Marion Caspars Klasse aus Versehen in zwei Gruppen unterteilt, und alle mussten sich wieder neu einloggen. Ein andermal schaltete sich eine Person mehr zu als angemeldet waren für den Unterricht. «Wir haben nicht herausgefunden, wer das war», erzählt die Studentin lachend.
Die Nutzung der technischen Tools fällt ihnen nicht schwer. Als Studiengangsvertreterinnen hören sich die beiden jungen Frauen aber auch um, wie es anderen ergeht. Da sie beide im Hauptstudium sind, betrifft sie die Umstellung auf den Fernunterricht weniger stark als manche anderen Kommilitoninnen und Kommilitonen. «Wer sich noch im Basisstudium befindet oder viele Module besucht, bekundet teilweise Mühe, dem digitalen Unterricht folgen zu können», sagt Caspar. Grundsätzlich ist aber viel Geduld und Verständnis vorhanden, wenn jemand ein bisschen länger braucht, um den richtigen Knopf zu finden. Umso wichtiger sei es, dass die Studierenden unterstützt und ihre Bedürfnisse aufgenommen werden. «Das wird enorm geschätzt», weiss Caspar.

«Die Dozierenden haben viel in die Umstellung ihres Unterrichts investiert und uns in jeder Hinsicht sehr unterstützt.»
Sara Steiner, Studiengangsvertreterin
Nicht alle Studierenden schaffen es, die Mehrfachbelastung von Studium, Erwerbstätigkeit und in manchen Fällen noch familiäre Aufgaben während des Corona-Ausnahmezustands zu bewältigen. Einige wenige nutzten die Möglichkeit, nachträglich ein Urlaubssemester einzureichen. Bei anderen, die ihr Studium nicht verlängern wollen, werden individuelle Lösungen gesucht, damit sie zu einem geordneten, regulären Studienabschluss kommen. Vergleichbare Möglichkeiten haben auch Teilnehmende von Weiterbildungsstudiengängen.
Offene Fragen zum Datenschutz
In der ersten Woche des Lockdowns setzte der Lehrbetrieb an der ZHAW zunächst ganz aus. In dieser Zeit gestalteten die Dozierenden den Kontaktunterricht neu. Von den im Frühlingssemester 2020 stattfindenden Modulen mussten insgesamt 4000 Kontaktlektionen im Bachelorstudium und über 200 Kontaktlektionen im Masterstudium auf Online-Unterricht umgestellt werden. Wie die Dozierenden das tun wollten, konnten sie grösstenteils selber entscheiden, je nach Zeit und Fähigkeiten. «Der individuelle Mehraufwand hing letztlich auch davon ab, wie online-affin jemand ist», sagt Miriam Fischer. Sie ist Verantwortliche beim E-Didaktik-Team, das die Mitarbeitenden berät und coacht – offenbar mit Erfolg.
«Die Qualität der Vorlesungen hat zum Teil gewonnen», sagt Sara Steiner. Der Dozent ihrer Lehrveranstaltung arbeitet mit Powerpoint und Videos, gibt Aufgaben für Gruppenarbeiten und das Selbststudium, die später online gemeinsam diskutiert werden. «Das ist sehr abwechslungsreich», findet die Studentin. Was es auch sein muss, schliesslich kann man nicht drei oder vier Stunden lang in den Bildschirm starren und zuhören. Sie würde es begrüssen, wenn diese Vielfalt in der Zeit nach Corona erhalten bleibt: «Ich hoffe sehr, dass die Dozierenden den Mut beibehalten, Neues auszuprobieren.»
Zuvor müssen allerdings Fragen des Datenschutzes sorgfältig geklärt werden. Darüber ist man sich einig. «Wir haben gerade alle Türen geöffnet. Das war wichtig, damit wir so viele Studierende erreichen wie möglich. Aber bekommen wir die Türen hinterher auch wieder zu?», gibt Tim Tausendfreund zu bedenken. Der Dozent am Institut für Kindheit, Jugend und Familie hat sich hauptsächlich für zwei didaktische Methoden entschieden: Synchrone Online-Diskussionsrunden sowie Screencasts, das heisst Präsentationen als Videoaufzeichnungen, die er auf die Lernplattform Moodle zum asynchronen Lernen hochlädt. Tausendfreund hat seinen synchronen Unterricht um 40 Prozent reduziert. Sein Ziel: ihn noch mehr reduzieren, noch gezielter auswählen. Zum einen, um die selbstbestimmte Zeiteinteilung der Studierenden beim Lernen zu unterstützen. Zum anderen wegen Datenschutzfragen, die ins Didaktische hineinspielen: «Viele Studierende wollen sich nicht vor einer unbekannten Öffentlichkeit exponieren, wie es der Fall ist, wenn man eine gemeinsame Diskussion aufzeichnet und im Internet zugänglich macht.»

«Ich stelle eine Tool-Fixiertheit fest.»
Dr. Tim Tausendfreund, Dozent ZHAW Soziale Arbeit
Die Vorlesung hat sich zwar als klassischer Bestandteil des Hochschulstudiums etabliert, ist aber lange nicht immer die adäquate didaktische Methode. So entstehen oftmals Redundanzen, weil Dozierende zentrale Lerninhalte wiederholt hervorheben müssen, wenn die Aufmerksamkeit unter den Studierenden natürlicherweise schwankt. Tim Tausendfreund nimmt die aktuelle Situation zum Anlass, um nach weiteren, besseren Formaten in der Online-Lehre zu suchen, ohne dabei die Studierenden mit neuen technischen Details zu belasten. «Ich stelle eine gewisse Tool-Fixiertheit fest, dabei geht es im Kern doch darum, dass wir an unseren Fachfragen arbeiten und erfolgreich Lerngemeinschaften etablieren», sagt der Sozialpädagoge.
Vor allem aber dürfe man das Wichtigste nicht vergessen: Die Menschen ausserhalb des Lehrbetriebs. Menschen, die gerade in einer Krisenzeit wie dieser auf Unterstützung angewiesen sind. «Unser Ziel muss sein, die aktuell wichtigen sozialen Fragen aufzugreifen und Inhalte nachhaltig zu vermitteln, um mehr Leute da draussen zu erreichen und ihnen zukünftig bedeutungsvollere Angebote machen können.»
Letztlich betrifft das ausser Lehre und Weiterbildung auch die beiden anderen Leistungsbereiche des Departements Soziale Arbeit, nämlich die Forschung und die Beratung. So kommt es laut dem interimistischen Direktor Frank Wittmann in mehreren Projekten zu Verzögerungen. Unter anderem mussten einige Feldstudien und Umfragen verschoben werden. «Die Zeit ist dennoch nicht verloren, sondern kann von den Forschenden unter anderem dazu genutzt werden, bereits vorliegenden Daten zu analysieren», sagt Wittmann. Was die Beratungen angeht, so werden Online-Dienstleistungen ausgearbeitet. Auch hier wird der Aufwand nicht umsonst sein: «Wir suchen nach Lösungen, die wir langfristig und für alle Seiten gewinnbringend nutzen können.»

Ziel des Qualitätskonzepts Ausbildung ist es, die Qualität der Ausbildung mehrperspektivisch zu evaluieren, kontinuierlich zu sichern und nachhaltig weiterzuentwickeln. Die Verantwortung für eine gelebte Qualitätssicherung, -entwicklung und -kultur in der Ausbildung tragen unterschiedliche Zielgruppen. Nebst den Studierenden sind dies beispielsweise die Lehrenden, die Leitung Zentrum Lehre, die Studienleitungen Bachelor und Master oder die Administration.
Je nach Zielgruppe der Ausbildung sind die verschiedenen Instrumente bzw. Austausch- und Diskursgefässe in unterschiedlicher Weise von Bedeutung. Die Abbildung stellt die Qualitätssicherung und -entwicklung aus der Perspektive der Studierenden dar.
Die Kommunikation und Validierung der Ergebnisse der Qualitätssicherung und -entwicklung erfolgt regelmässig zielgruppenspezifisch über institutionalisierte Informationsgefässe und -kanäle.
Das traditionelle Versorgungssystem bietet Sicherheit
Traditionell verteilen Kantone ihre Gelder an Leistungsanbieter, üblicherweise an stationäre Einrichtungen. Das ist die sogenannte Objektfinanzierung. Die Kantone vereinbaren mit den Anbietern die Anzahl Plätze und in welcher Qualität zu welchen Kosten die Unterstützungsleistungen zu erbringen sind. Sie stellen für Menschen mit Behinderung also ein Versorgungssystem bereit, das sie planen, ressourcieren und beaufsichtigen. Dieses traditionelle System bietet allen Beteiligten viel Sicherheit: Planungssicherheit, finanzielle Sicherheit, Angebotssicherheit.
Warum das System umstellen – worin liegt der Zweck?
Wie kommt ein Kanton also auf die Idee, von der Objekt- auf eine Subjektfinanzierung umzustellen? Und wie kann er das tun? Klar: Er möchte mehr Selbstbestimmung ermöglichen. Allerorten spornt die UNO-Behindertenrechtskonvention an, die bisherige Praxis zu überdenken. Ein System aus vordefinierten Angeboten kann man zwar gut bedienen, aber es schränkt die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten ein.
Konzeptionell muss nun klar werden, was der Franken denn anderes tun soll, als er bisher getan hat. Die Erfahrung zeigt: Die Oberhand gewinnt schnell die Frage, wie das Budget neu zu verteilen ist. Wer erhält künftig über welchen Prozess in welchem Umfang finanzielle Mittel? Am Ende fliessen die Gelder anders als zuvor – aber was hat man erreicht?
Nötig ist also ein gutes Grundverständnis der Subjektfinanzierung. Wofür ist sie da? Wofür nicht? Und das kann man verschieden sehen. Wir befassen uns seit einigen Jahren mit dem Thema. Unsere Herangehensweise ist wie folgt.
Nicht versorgt werden, sondern handeln und gestalten
Die Subjektfinanzierung stellt Menschen mit Behinderung mit ihren Potenzialen und Ideen ins Zentrum. Sie sollen nicht als blosse Empfänger von Unterstützung betrachtet werden – es geht nicht darum, sie zu versorgen oder ihre Beeinträchtigung zu kompensieren. Im Gegenteil: Sie sollen als Handelnde gesehen und anerkannt werden und über ihre Lebensgestaltung entscheiden können.
Das hat weit reichende Folgen. Es ist, im Kleinen wie im Grossen, die einzig taugliche Haltung für die Arbeit von, mit und für Menschen mit Behinderung. Mit der Subjektfinanzierung hält diese Haltung ins System selbst Einzug – als Prinzip, nach dem die notwendigen Unterstützungsleistungen konstruiert sein sollen. Doch um welche Entscheide geht es? Was soll Menschen mit Behinderung möglich sein? Was heisst entscheiden?
Es geht um die grossen Entscheide
Die Subjektfinanzierung zielt auf die grossen Entscheide im Leben: Überhaupt die Wahl zu haben, wo man mit welcher Unterstützung leben will. Nicht in eine stationäre Einrichtung zu müssen, um einen Anspruch auf Unterstützungsleistungen zu haben. Eine Unterstützung zu erhalten, die den persönlichen Lebensvorstellungen entspricht.
Bedarfe decken, nicht Wünsche erfüllen
Das ist nicht mit Wunscherfüllung zu verwechseln. Es werden nämlich nicht Wünsche wahr, sondern Bedarfe gedeckt: Es kann immer nur um das gehen, was für alle aus guten Gründen anzuerkennen ist und keinem Menschen vorenthalten werden kann. Ziel eines jeden Kantons ist es, dass jeder Mensch mit Behinderung die angemessene Unterstützung erhält. Und mit der Subjektfinanzierung hat er eine innovative Leitidee auf dem Tisch, das zu erreichen.
Die praktische Prüfgrösse: Entscheiden heisst, die Person kann sich zu den Geldern verhalten
Menschen mit Behinderung entscheiden, wie sie ihre Mittel einsetzen. Das ist der unverrückbare Ausgangspunkt der Subjektfinanzierung. Es kommt darauf an, was sie mit den Geldern tun und sein können, ob sie tatsächlich Entscheidungen treffen können. Wie die Gelder also fliessen, ist entgegen häufig gehörter anderer Ansichten zweitrangig – dass Menschen mit Behinderung den Überblick haben und dass für sie klar ist, welche Mittel sie haben und für welche Unterstützungsleistungen sie diese einsetzen können, ist erstrangig.
Natürlich sieht der Prozess des Selberentscheidens unterschiedlich aus. Es wird Menschen geben, die auf Begleitung und Support angewiesen sind. Gerade Menschen mit eingeschränkter Autonomie- und Handlungsfähigkeit sind der Prüfstein für die Umsetzung der Subjektfinanzierung. Ein Leben lang bin ich es gewohnt, dass andere Entscheidungen für mich treffen und umsetzen – jetzt muss ich zuerst lernen, die Rolle als Handelnder einzunehmen. Lernen, sich mit sich selber und den eigenen Bedürfnissen auseinandersetzen, Erfahrungen mit Freiräumen sammeln und Selbstwirksamkeit erleben, dieser Prozess kann mehrere Monate oder Jahre dauern. Bei Menschen mit schwersten Beeinträchtigungen kann es sein, dass diese schwierige Rolle stellvertretend übernommen werden muss. Aber genau dann, wenn gängige Denkweisen zur Disposition gestellt sind und eine aktive Auseinandersetzung geführt wird, fallen tatsächlich grosse Lebensentscheide.
Befragung von Studierenden
Die Expertengruppe war im Juni 2019 zwei Tage an unserem Departement und führte insgesamt zehn Gruppeninterviews durch. Im Rahmen dieser Gruppeninterviews wurde auch eine Gruppe von fünf Bachelorstudierenden befragt. Thema der Befragungen waren die vier Leistungsbereiche «Lehre», «Forschung und Entwicklung», «Dienstleistung» und «Weiterbildung». Zur Beurteilung der Lehre wurde das Bachelorstudium evaluiert.
Grosse Zufriedenheit geäussert
Über die positiven Ergebnisse freuen wir uns sehr. Ganz besonders erfreulich ist die grosse Zufriedenheit der Studierenden mit dem Studium. Dieses entspricht ihren Bedürfnissen und Erwartungen und wird als relevant für die weitere Berufslaufbahn eingeschätzt. Auch wurde seitens der externen Expertengruppe generell die gelungene Umsetzung verschiedener Reformen und Entwicklungen in der Ausbildung positiv erwähnt. Besonders hervorgehoben hat die externe Expertengruppe zudem die gelungene Umsetzung der fachlichen Profilierung des Bachelorstudiums sowie die Umsetzung des generalistischen Verständnisses der Sozialen Arbeit mit Vertiefungsmöglichkeit.
Weiterentwicklungspotenzial
Auf der Grundlage der Empfehlungen der Expertengruppe sehen wir Handlungsbedarf in der weiteren Stärkung der Bedeutung von Forschung und Theorie im Bachelorstudium. Zudem möchten wir einige Überlegungen und Vorschläge zur Weiterentwicklung aufgreifen. Hierzu gehören beispielsweise die Reduktion von Abhängigkeiten bei den Moduleinschreibungen im Hauptstudium oder die Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit von Moodle.
Für die geplanten Weiterentwicklungen beziehen wir gerne weiterhin die Studierendenvertretung sowie den Beirat Studierende mit ein.
Herausforderungen für Care Leaver
Nach einer Einleitung ins Thema durch Prof. Dr. Thomas Gabriel, Leiter des Instituts für Kindheit, Jugend und Familie der ZHAW, und einem Grusswort von Severina Eggenspiller, Wissens- und Prozessmanagerin bei der Stiftung Mercator Schweiz, wurden in den beiden Hauptreferaten die Ergebnisse zweier Forschungs- und Entwicklungsprojekte der FHNW und der ZHAW vorgestellt. Während das Referat von Dorothee Schaffner, Angela Reim, Lukas Höfler und Sophia Zimmermann die Situation von ehemaligen Heimkindern beleuchtete, thematisierte das Referat von Karin Werner und Thomas Woodtli den Übergang in die Selbständigkeit von Pflegekindern. Beide Referate wurden von Care Leavern mitgestaltet. Die Inhalte erhielten vor dem Hintergrund ihrer persönlichen Erfahrungen eine zusätzliche Bedeutung.
Zwei Webseiten und eine Filmpremiere
Im Rahmen der Referate wurden auch zwei Webseiten vorgestellt, die in den beiden Projekten von jungen Care Leavern und den Projektteams entwickelt wurden. Ziel der Webseiten ist es u.a. die in den beiden Forschungs- und Entwicklungsprojekten gewonnenen Erkenntnisse einer breiteren Zielgruppe zugänglich zu machen.
Die Webseite careleaver-info.ch der FHNW und des bürgerlichen Waisenhaus Basel richtet sich primär an Care Leaver aus der Region Basel und ist ab dem 25. September 2019 online.
Die Webseite careleaver.ch der ZHAW, Institut für Kindheit, Jugend und Familie, richtet sich an Care Leaver aus der Deutschschweiz.
Beide Webseiten sollen es ehemaligen Pflege- und Heimkindern ermöglichen, sich über relevante Themen zu informieren und sich mit anderen Care Leavern zu vernetzen.
An der Tagung feierte zudem der Film „Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!“ Premiere. Der Film wurde von ehemaligen Pflegekindern im Rahmen des ZHAW-Projekts entwickelt. Er zeigt auf, welchen Herausforderungen sich Pflegekinder beim Übergang in die Selbständigkeit stellen müssen, aber auch, was ihnen dabei geholfen hat.
Vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema
Am Nachmittag konnten die Tagungsteilnehmenden zwei von insgesamt sechs Workshops besuchen. In den Workshops wurden unter Mitwirkung von Care Leavern Inhalte aus den Referaten vertieft und Praxisbeispiele von Begleitungen in die Selbständigkeit vorgestellt.
Beeindruckende Statements von Care Leavern
Zum Schluss der Tagung gehörte die Bühne ganz den jungen Erwachsenen. In beeindruckenden Statements forderten sie die anwesenden Fachleute auf, die Anliegen von Pflege- und Heimkindern ernst zu nehmen, ihnen zuzuhören, sie zu beteiligen und sich auch auf gesetzlicher Ebene für verbesserte Rahmenbedingungen einzusetzen.
Präsentationen zum Download
Gegennarrative und alternative Narrative
Als Gegennarrative werden Botschaften verstanden, die sich explizit gegen radikale und extremistische Botschaften wenden, diese dekonstruieren, demystifizieren oder diskreditieren. Alternative Narrative wenden sich nicht gegen eine vorhandene Botschaft, sondern fokussieren auf die Vermittlung positiver Inhalte. Themen sind zum Beispiel Toleranz, Interkulturalität und Interreligiosität, soziale Integration sowie Werbung für Demokratie und Rechtsstaat.
Evaluation des Pilotprojekts
Die Evaluation sollte der Qualitätssicherung dienen und Wissen über die Umsetzung von Pilotprojekten zu Gegennarrativen und alternativen Narrativen gewinnen, Verbesserungspotenzial identifizieren und Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung und Optimierung der Pilotprojekte erarbeiten. Um die Wirkung der Narrative beurteilen zu können, wurden Gruppendiskussionen mit Jugendlichen in Schulklassen und in Jugendtreffs geführt sowie verschiedene Expertinnen und Experten befragt. Weiter wurde eine standardisierte Online-Befragung durchgeführt, um die Einschätzungen Jugendlicher und junger Erwachsener zu diesen Narrativen sowie weitere Hinweise auf eine mögliche Wirkung zu erheben. Schliesslich wurde die Verbreitung der Narrative basierend auf Klickzahlen analysiert.
Ausgewählte Projekte
- Winfluence: Dieses Projekt erarbeitete und verbreitete zusammen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen fünf Motion-Comic-Videoclips, die sich Themen wie Gewalt in Paarbeziehungen und Fremdenfeindlichkeit widmeten.
- KnowIslam: Dieses Pilotprojekt erstellte einerseits Bildtexte (Zitate aus dem Koran) und andererseits Informationsvideos über den Islam (z.B. zum Menschenbild, zum Thema Gewalt im Islam).
- SwissMuslimStories: Dieses Projekt fertigte kurze Portraitvideos von muslimischen jungen Erwachsenen an und veröffentlichte diese über unterschiedliche Soziale Medien.
- PositivIslam: Im Gegensatz zu den anderen Projekten handelt es sich bei diesem Projekt um ein französisch- bzw. italienischsprachiges Projekt, in dessen Rahmen keine Videoclips, sondern von jungen Bloggerinnen und Bloggern verfasste Posts erstellt und online verbreitet wurden.
Erfreuliche Erkenntnisse
Positiv ist festzuhalten, dass Narrative geschaffen wurden, die von den Jugendlichen und jungen Erwachsenen überwiegend korrekt verstanden und positiv eingeschätzt wurden. Da das Internet und die sozialen Medien für diese Zielgruppe auch künftig von hoher sozialisatorischer Bedeutung sein werden, wären vergleichbare Pilotprojekte zu begrüssen. Wenn staatliche Akteure in den Prozess von Narrativen involviert sind, ist eine Form der Validierung der erstellten Produkte nicht zu umgehen, um deren Qualität zu sichern, deren Botschaften zu prüfen und damit möglichen Bumerang-Effekten vorzubeugen. Dies ist im Falle der Pilotprojekte gelungen.
Die Evaluation lässt darauf schliessen, dass die erarbeiteten Narrative präventiv wirksam sein können, insofern sie Vorurteile abbauen können, Vielfalt aufzeigen und für Toleranz werben. Anspruch der Narrative war es nicht, bereits radikalisierte Personen zu de-radikalisieren: Hierzu braucht es intensivere Massnahmen. Auch ersetzen die Narrative nicht anderweitige Präventionsmassnahmen, die sich der Verbesserung der gesellschaftlichen Teilhabe vulnerabler Gruppen widmen.
Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die für die Projekte gewonnen werden konnten, beurteilten sie positiv und schätzten die Möglichkeit zur Mitwirkung. Sie erlebten hierdurch einen Wissenszuwachs und eine Sensibilisierung bezüglich der Thematiken. Dank der Mitwirkung von Jugendlichen konnte zudem die Authentizität der Narrativen gesteigert werden.
Herausforderungen für künftige Projekte
Die Verbreitung der Narrative ist nur bedingt gelungen. Zwar wurden zum Teil hohe Aufrufzahlen erzielt – dies aber in der Regel nur durch Bewerbung der Narrative. Diskussionen wurden darüber eher nicht ausgelöst. Es gilt, eine optimale Strategie zur Verbreitung der Produkte zu finden. Weiter sind die Zukunft und die Nachhaltigkeit der Projekte bislang nicht sichergestellt. Es besteht die Gefahr, dass es sich um einmalige Aktionen handelt, die nicht weitergeführt werden. Um dem entgegenzuwirken, sind mehrere Strategien denkbar: So könnten zum Beispiel Materialien erarbeitet werden, die Lehrkräften und anderen mit Kindern und Jugendlichen arbeitenden Fachleuten dabei helfen, die Videos in die eigene Tätigkeit zu integrieren.
Bedürfnisse in verschiedenen Bereichen
Die dringendsten Bedürfnisse der Befragten lassen sich in vier verschiedene Bereiche zusammenfassen.
Wohnen: Im Bereich Wohnen wünschen sich die Befragten vor allem mehr bezahlbaren Wohnraum und dass der soziale Wohnungsbau gefördert wird. In Stadtrandquartieren ist es ihnen zudem wichtig, dass Angebote für Treffpunkte unterstützt werden, welche die Kreativwirtschaft und den Konsum fördern, den neuen Altersgruppen gerecht werden und Diversität begünstigen.
Vereinbarkeit von Beruf und Familie: Die Studienteilnehmenden erachten eine Analyse der konkreten Vereinbarkeitsprobleme in Bezug auf die Betreuung als wichtigen Ansatz. Problematisch sehen sie in diesem Bereich etwa die dezentralen Betreuungsangebote und die wenig flexiblen Betreuungszeiten. Das Angebot müsste besser den Berufsanforderungen angepasst werden und die Betreuungskosten fallen derzeit zu hoch aus.
Freiraum- und Lebensqualität: Die Befragten schätzen Zürich in diesem Bezug sehr und wünschen sich, dass das grosse Angebot an Stadt- und Quartierplätzen, Treffpunkten und Kultur erhalten bleibt. Sie regen gleichzeitig an, dass die Velowege und die Signalisation ausgebaut werden sollten und die Sicherheit erhöht werden müsste. Zudem äusserten sie den Wunsch nach Freiräumen zur (Zwischen-)Nutzung für alternative Ideen, die Diversität fördern und unterschiedliche Bedürfnisse einbeziehen.
Partizipation und Information: Gemäss der Studienteilnehmenden müssten Informationen zu städtebaulichen Entwicklungen, Planungen und Diskussionen im Stadtraum breiter und häufiger publiziert werden. Dafür brauche es neue Formate für partizipative Prozesse und Netzwerke zur Informationsvermittlung. Für Ausländerinnen und Ausländer wünschen sie sich dringend ein Stimm- und Wahlrecht oder spezifische Mitwirkungsrechte auf Gemeinde-/Quartierebene.
Detaillierte Angaben zur Studie sowie zu den Handlungsempfehlungen finden sich im Schlussbericht zur Studie. Einen kurzen Überblick über die Studie gibt zudem die Projektseite.
Zwischen Gesetzen und Rollenbildern
Die bürgerliche Geschlechterordnung, in der die Mutter als Erzieherin der Kinder betrachtet wurde, und Vorstellungen von einer auf Arbeit und Leistung basierenden Gesellschaft prägten die Begründungen der Behörden – und schränkten den Handlungsspielraum der Kinder, Jugendlichen und ihrer Eltern ein. Armutsbetroffene Familien standen im Brennpunkt. Auch alleinerziehenden Müttern, die unter prekären Rahmenbedingungen Beruf und Familie zu vereinbaren suchten, drohten vormundschaftliche Massnahmen. Unterstützende Beratungsangebote gab es kaum. Schliesslich kamen sehr oft Jugendliche, die auf einer selbstbestimmten Lebensweise bestanden, mit den Behörden in Konflikt. Dies sind einige der Themen, die die Autorinnen mit sozialwissenschaftlichem und historischem Hintergrund in ihrem Buch behandeln und eingebettet in den damaligen Kontext ausführen.
Qualität ohne Wirkung?
Vom neuen Gesetz verspricht sich der Kanton eine bessere Gesamtplanung der ergänzenden Hilfen zur Erziehung. Verpflichtet sind die kantonalen Planer in ihren Entscheidungen per Gesetz auf die Grundsätze der Wirksamkeit, Qualität und Wirtschaftlichkeit. Drei Begriffe also. Reichen nicht zwei? Geht es bei der Entwicklung von Qualität nicht darum, jene Voraussetzungen zu schaffen, unter denen beabsichtigte Wirkungen möglich werden? Ist Qualität insofern nicht genauer ein Mittel zum Zweck der Wirksamkeit?
Im Diskurs um wirksame Praxis in sozialpädagogischen Handlungsfeldern gibt es die Stimmen, die das verneinen und die Qualität einer Hilfe von ihrer Wirkung trennen. Dahinter steht ein Prinzip, für das die Alltagssprache einen bündigen Ausdruck gefunden hat: «Operation gelungen, Patient verstorben». Das klingt zynisch, ist so abwegig aber nicht. Denn es kommt vor, dass eine Ärztin in einer vorbildlich organisierten Klinik nach allen Regeln ihrer Kunst operiert und doch das Leben der Patientin nicht erhalten kann. Genauso mag es vorkommen, dass eine Sozialpädagogin in einer denkbar professionell aufgestellten Organisation nach allen Regeln ihrer Kunst handelt und doch nicht dazu beitragen kann, dass sich das Leben einer Familie zum Besseren wendet. Wirkung und Qualität sind zweierlei.
Fehlendes Wissen
Nur: Diese Unterscheidung lässt sich nicht vom Einzelfall lösen und verallgemeinern. Kann eine Form von Hilfe, die in der Regel nicht die beabsichtigte Wirkung hat, qualitativ überzeugen? Das zu bejahen, wäre tatsächlich zynisch, mindestens arg kleinmütig mit Blick auf das Potenzial der helfenden Zuwendung. Der Gedankengang zeigt vielmehr, dass Qualität in sozialpädagogischen Hilfen zwar nicht im Einzelfall, aber doch im Allgemeinen eng auf Wirkungen bezogen sein muss.
Dass das neue Kinder- und Jugendheimgesetz zwischen Wirksamkeit und Qualität unterscheidet, hat seinen Grund nicht darin, dass Wirksamkeit und Qualität gleichwertige Prinzipien sind. Es hat nur damit zu tun, dass wir über die Wirksamkeit sozialpädagogischer Hilfen kaum etwas wissen. Deshalb verschiebt sich die Diskussion hin zur Qualität und ihren mutmasslichen Indikatoren. Der Gesetzgeber muss so tun, als sei Qualität ein Grundsatz sui generis.
Über die Wirksamkeit sozialpädagogischer Hilfen wissen wir so wenig, weil es aufwendig ist, diese Wirksamkeit systematisch zu untersuchen. In einer mehrjährigen Studie unternimmt das Institut für Kindheit, Jugend und Familie aktuell den Versuch dazu. Warum?
Das könnte Sie auch interessieren
Weiterbildung
Das Weiterbildungsangebot im Bereich Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe wird laufend aktuellen Entwicklungen angepasst und zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus.
Forschung und Entwicklung
Die Forschenden am Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe arbeiten interdisziplinär und orientieren sich an nationalen und internationalen Fachthemen.
Newsletter Soziale Arbeit
Möchten Sie über praxisrelevante Themen und neueste Forschungsergebnisse informiert sein?
Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Mehr zu unseren inhaltlichen Schwerpunkten und Mitarbeitenden.
Weiterbildung
Forschung und Entwicklung
Newsletter Soziale Arbeit
Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Das Weiterbildungsangebot im Bereich Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe wird laufend aktuellen Entwicklungen angepasst und zeichnet sich durch einen hohen Praxisbezug aus.
Die Forschenden am Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe arbeiten interdisziplinär und orientieren sich an nationalen und internationalen Fachthemen.
Möchten Sie über praxisrelevante Themen und neueste Forschungsergebnisse informiert sein?
Mehr zu unseren inhaltlichen Schwerpunkten und Mitarbeitenden.
Zu den Autorinnen
Die beiden Autorinnen haben im Chronos Verlag verschiedene weitere Bücher und Aufsätze zum Thema publiziert. Nähere Angaben dazu finden sich in ihren Profilen:
Susanne Businger, Nadja Ramsauer
«Genügend goldene Freiheit gehabt»
Heimplatzierungen von Kindern und Jugendlichen im Kanton Zürich, 1950–1990
Susanne Businger, Nadja Ramsauer
Chronos Verlag, 2019
240 Seiten
ISBN 978-3-0340-1500-4
Buch online bestellen
Probleme lösen
In den Fünfzigerjahren des letzten Jahrhunderts freuten sich Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten über den Befund, dass sie erfolgreich waren. Den meisten ihrer Patientinnen und Patienten ging es nach der Therapie besser als vorher. Wissenschaftliche Studien bestätigten, was Praktikerinnen und Praktiker schon lange wussten. Doch dann kam jemand auf die Idee, nachzuprüfen, wie sich andere Menschen mit denselben Störungen ohne Psychotherapie in der gleichen Zeitspanne entwickelten. Siehe da: Auch denen ging es nachher besser als vorher! Diese Entdeckung führte zur Entwicklung einer ernstzunehmenden Therapieforschung. Ihr Grundsatz ist, dass unterschiedliche Behandlungsansätze (darunter den Ansatz der Nicht-Behandlung) in ihrer Wirksamkeit miteinander verglichen werden.
In der Forschung zu sozialpädagogischen Handlungsfeldern, zumal in den deutschsprachigen Ländern, hat diese schlichte Idee bisher kaum Anklang gefunden. Hier wimmelt es von kritischen Aufsätzen, die die vergleichende Wirkungsforschung für praktisch undurchführbar erklären, sie ethisch problematisieren oder ihr ideologisch die Daseinsberechtigung absprechen. Nur zaghaft entwickeln sich empirische Studien, die darauf angelegt sind, die Probleme der Wirkungsforschung nicht nur gedankenvoll zu reflektieren, sondern zu lösen.
Den Zufall nutzen
Das Design der ZHAW-Studie beruht auf der Idee, sich eine unvermeidbare Zufälligkeit zunutze zu machen. Wenn Eltern in der Schweiz in ihrer Erziehungsfähigkeit stark überfordert sind (oder Fachpersonen den Eindruck haben, sie seien es), dann hängt die Antwort auf die Frage, ob die Familie künftig sozialpädagogisch unterstützt wird – und wenn ja, in welcher Form –, von zahlreichen Faktoren ab, die in ihrem Zusammenspiel etwas Zufälliges haben. Beispielsweise spielt eine Rolle, welches sozialpädagogische, pädagogische oder familientherapeutische Angebot in der Region überhaupt verfügbar ist, wie gut etabliert die Beziehung der zuweisenden Stelle (z. B. der KESB) zu den entsprechenden Anbietern ist oder ob sich eine geeignete Finanzierung findet. Faktisch ist es deshalb so, dass Familien mit ähnlichem Unterstützungsbedarf unähnliche Leistungen in Anspruch nehmen.
Was die neue Studie bringen soll
Durch die Zusammenarbeit mit zahlreichen Anbietern von sozialpädagogischen Familienbegleitungen und verwandten Hilfeformen (z. B. Erziehungsberatung, Familientherapie) versuchen wir herauszufinden, ob sich zwischen den Hilfeformen kurz-, mittel- und langfristig unterschiedliche Verläufe ergeben – in Fällen, die von ihren Ausgangslagen her ähnlich gelagert sind. Dabei werden auch Familien in die Studie aufgenommen, die überhaupt keine Form professioneller Unterstützung erfahren, obwohl diese indiziert sein könnte.
Die Studie wird durch den Schweizerischen Nationalfonds gefördert. Erste Ergebnisse erwarten wir für Ende 2020, also kurz vor dem Zeitpunkt, an welchem das neue Kinder- und Jugendheimgesetz des Kantons Zürich in Kraft treten wird. Zu hoffen ist, dass die Studie dann dazu beitragen wird, den luftigen «Grundsatz» der Qualität durch empirische Befunde zu erden.
Statt zu berücksichtigen, dass Kulturen und homogene ethnische Gruppen höchstens in unseren Köpfen existieren, dass sich Kulturen laufend wandeln und dass Kultur überdies lange nicht für alle Menschen die gleiche Bedeutung hat, wird diese scheinbare Wesensdifferenz immerzu wiederholt und von Neuem bekräftigt. Der Integrationsdiskurs begünstigt damit die Wahrnehmung der Welt durch eine ethnische beziehungsweise kulturelle Brille und verwechselt diese Sicht mit der Wirklichkeit.
In Integrationsfragen lassen sich Theorie, Politik und Praxis nicht losgelöst voneinander betrachten, sondern sie sind eng aufeinander bezogen. In der Praxis beobachtbare Phänomene und Problematiken sind damit zwingend auch vor dem Hintergrund von politischen Entwicklungen, theoretischen Debatten und der sich wandelnden Bedeutung wichtiger Begriffe zu verstehen. Im Rahmen eines White Papers reflektieren Eva Mey und Peter Streckeisen vom Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe die drei Dimensionen. Mit ihrem bewusst kritischen Beitrag möchten sie die Diskussion zur aktuellen Integrationspolitik und -praxis anregen. Darüber hinaus ist das White Paper mit dem Ziel verbunden, in Kooperation mit Fachpersonen aus der Praxis einen Leitfaden mit Prinzipien, Ansätzen und Beispielen von «good practice» zu entwickeln.
Eine Reform mit Schwächen
Seit 2014 beschäftigen sich Bundesrat und Parlament mit der Reform der EL. Sie soll drei Ziele verfolgen: Erhalt des Leistungsniveaus, stärkere Verwendung der Eigenmittel und Verringerung der Schwelleneffekte. Nach langen und kontroversen Diskussionen hat das Parlament am 22. März 2019 die Reform verabschiedet, die voraussichtlich 2021 in Kraft treten wird. Übergangsbestimmungen sehen Folgendes vor: Führt die EL-Reform bei Betroffenen zu Kürzungen, werden diese frühestens 3 Jahre nach Einführung erfolgen. Führt die Reform zu einer Erhöhung der EL, erfolgt diese sofort. Dem Ständerat ist es gelungen, den Nationalrat mit seinen Sparmassnahmen in die Schranken zu weisen, dennoch kann das Resultat nicht nur überzeugen, wie die nachfolgenden Ausführungen zeigen. Es werden in der Folge nur ausgewählte Reformpunkte kurz skizziert und deren Auswirkungen auf die Sozialberatung aufgezeigt. Eine ausführliche Übersicht über alle Reformpunkte findet sich auf der Website des Bundesamts für Sozialversicherungen.
Ursula Blosser tritt nach knapp 12 Jahren als Direktorin des Departements in den Ruhestand
Ende Mai 2019 ist Prof. Dr. Ursula Blosser in den Ruhestand getreten. Ursula Blosser war seit 2006 Rektorin der Hochschule für Soziale Arbeit Zürich (HSSAZ). Seit der Entstehung der ZHAW im Jahr 2007 war sie Direktorin des Departements Soziale Arbeit und prägte in dieser Funktion dessen Entwicklung und Positionierung. Mit dem Ziel, der Verfachlichung der Sozialen Arbeit Schub zu geben und die Wirkungen von Interventionen belegbar zu machen, legte das Departement unter Ursula Blosser einen starken Fokus auf Forschung und Entwicklung und deren Verbindung mit der Lehre. Mit diesem Fokus leistete es einen Beitrag zum Verständnis und zur Bearbeitung von sozialen und gesellschaftlichen Fragestellungen. Von diesem Anliegen geleitet, wurden das Bachelor- und das Masterstudium erarbeitet und in Zusammenarbeit mit der Praxis stetig weiterentwickelt: Eine Entwicklung, die im eigenständigen Master mit Schwerpunkt «Transitionen und Interventionen» mündet, den das Departement ab Herbst 2019 anbietet.
Eine ganz besondere Anspruchsgruppe
UMA sind nicht «einfach» etwas jüngere und allein gereiste Asylsuchende. Es sind minderjährige Menschen, deren Schutz und Wohlergehen auf der Grundlage internationaler Abkommen und nationaler Gesetzgebung in der Verantwortung des Staates liegen, der gefordert ist, diese umzusetzen.
Aufgrund der Minderjährigkeit, der Trennung von wichtigen Bezugspersonen und der Fluchtsituation ist insgesamt von einer erhöhten Vulnerabilität und von einem hohen Bedarf an Identitäts- und Perspektiventwicklung auszugehen, wenngleich die Gruppe der UMA heterogen ist und die Geschichten, Belastungen und Ressourcen der Kinder und Jugendlichen höchst unterschiedlich sind. Während die einen einigermassen zurechtkommen, sind andere – auch aufgrund traumatischer Erfahrungen während der Flucht oder im Herkunftsland – höchst verletzlich und schutzbedürftig.
Erhöhung der Mietzinsmaxima
Die für die EL anrechenbaren Mietzinsmaxima werden endlich angehoben. Mit den bisherigen Mietzinsen von maximal CHF 1’100 für Einzelpersonen und CHF 1’250 für Ehepaare deckten die Mietzinsmaxima 2017 die Mieten von lediglich 68% der Alleinstehenden und 63% der Ehepaare ab. Insbesondere in den Städten waren die Ansätze deutlich zu tief: Rentenberechtigten stand dadurch weniger Geld für ihre alltäglichen Ausgaben zur Verfügung. Die Mietzinsmaxima werden bedarfsgerechter ausgestaltet, indem neu regionale Unterschiede sowie bei Mehrpersonenhaushalten höhere Mieten berücksichtigt werden können. Je nach Region und Haushaltsgrösse beträgt die Erhöhung zwischen 10% und 60%.
Wichtige Verbesserungen erzielt
Dank der neuen Vorgaben, der angepassten Ressourcen und des hohen Engagements der Fachpersonen vor Ort wurden im Rahmen des UMA-Pilotprojektes bereits wichtige Verbesserungen bei der Unterbringung und Betreuung von UMA erzielt. So konnten insbesondere mit dem Einsatz von sozialpädagogischen Fachpersonen Fortschritte in Bezug auf einen verbesserten Zugang zu den Kindern und Jugendlichen erreicht werden. Dies ist entscheidend, um spezifische Bedarfe zu erkennen. Regelmässig stattfindende Einzelgespräche erwiesen sich dabei als ebenso wichtig wie ein vermehrter fachlicher Austausch innerhalb des Betreuungsteams und über disziplinäre Grenzen hinweg. Hier wurde in der Pilotphase bereits viel Aufbauarbeit geleistet, um geeignete Abläufe und Gefässe einzurichten. Die sozialpädagogischen Fachkräfte nehmen nebst der direkten Arbeit mit den UMA also auch zentrale Koordinations- und Vernetzungsaufgaben wahr, die für eine fachlich angemessene Begleitung entscheidend sind.
Mehr Geld für Miete – aber nicht für alle
In der Sozialberatung ist auf eine wichtige Neuerung hinzuweisen. Die Erhöhung der Mietzinsmaxima führt in vielen Fällen zu einer geringeren Ausgabenlast. Dies gilt aber nicht zwingend für Personen, die in einer Wohngemeinschaft oder im Konkubinat leben. Sie erhalten derzeit maximal den Betrag für eine Einzelperson als Mietzins, neu wird die Miete anhand der Anzahl Personen im Haushalt berechnet. Heute wird einer im Konkubinat lebenden AHV-Rentnerin ein Mietzinsmaximum von CHF 1’100 angerechnet, wenn ihre Wohnung CHF 2’200 kostet. Ab 2021 werden nur noch CHF 810 (1/2 von 1’370 + 250) als Mietzinsausgabe berücksichtigt. Diese Regelung entspricht der Handhabung bei der Berechnung der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Insbesondere für Erwachsene mit einer Behinderung, die bei ihren Eltern oder in einer Wohngemeinschaft leben, kann sich die finanzielle Situation somit deutlich verschlechtern.
Handlungsbedarf insbesondere an den Schnittstellen
Gleichzeitig machen die Befunde aus der Evaluation aber auch deutlich, dass nach wie vor grosser Handlungsbedarf besteht. Dazu gehören wichtige konzeptionelle Grundlagen ebenso wie personelle Ressourcen und räumliche Anpassungen. Insbesondere aber fehlt es derzeit noch an einer Klärung wichtiger Schnittstellen, damit in einem primär von Verwaltungslogik strukturierten Kontext kindes- und altersgerechte Lebensbedingungen geschaffen werden können sowie individuelle Bedarfs- und Gefährdungslagen systematisch erkannt werden und eine adäquate Reaktion darauf möglich ist. Schliesslich fällt auf, dass die Anbindung an Angebote der Kinder- und Jugendhilfe mangelhaft ausgestaltet ist und kein unabhängiges Kontrollorgan existiert, das Kindes- und Altersgerechtigkeit langfristig überprüfen könnte. Das Evaluationsteam formulierte eine Reihe von Empfehlungen, die wesentlich sind, um eine kindes- und altersgerechte Unterbringung und Betreuung in den Zentren des Bundes sicherstellen zu können.
Stärkere Berücksichtigung des Vermögens
Neben den Renteneinnahmen wird bei der Berechnung der EL auch der Anteil des Vermögens berücksichtigt, der über dem Freibetrag liegt. Dieser Freibetrag wird bei Alleinstehenden von CHF 37‘500 auf CHF 30’000 und bei Ehepaaren von CHF 60‘000 auf CHF 50’000 reduziert. Während diese Reduktion in der Logik des EL-Systems bleibt, sind von der Sozialhilfe zwei Regelungen übernommen worden, die schlecht zu einer Sozialversicherung passen. Die eine Anpassung betrifft die Einführung einer Vermögensschwelle für den Bezug von Ergänzungsleistungen. Auch wenn die Eintrittsschwelle mit CHF 100’000 für Alleinstehende und CHF 200’000 für Ehepaare eher hoch angesetzt ist, widerspricht sie klar dem Ziel der Reform, die Schwelleneffekte zu verringern. Absolut systemwidrig ist die Verpflichtung zur Rückerstattung der rechtmässig bezogenen EL. Übersteigt das Erbe einer verstorbenen EL-berechtigten Person CHF 40’000, ist der EL-Bezug rückerstattungspflichtig. Bei Ehepaaren erfolgt die Rückerstattung beim Zweitverstorbenen. Auch wenn diese Rückerstattung nur die Erben einer EL-berechtigten Person betrifft, lässt sich dies nicht mit dem eigentlich unantastbaren Grundsatz der Sozialversicherungen vereinbaren, dass nur unrechtmässig bezogene Leistungen zurückzuerstatten sind.
Anrechnen, was nicht mehr vorhanden ist
Ein noch weitergehender Tabubruch ist die Neuregelung bei einer Vermögensverminderung. Heute wird nur sanktioniert, wer Vermögenswerte verschenkt oder einen Erbvorbezug tätigt. Das Bundesgericht hat in steter Rechtsprechung die Durchführungsstellen wiederholt ermahnt, dass diese keine Lebensführungskontrollen vornehmen dürfen. Konnte belegt werden, dass Vermögen für eigene Bedürfnisse verwendet wurde, so musste dies von der Verwaltung akzeptiert werden. Mit dem Argument, dass Transparenz und Rechtssicherheit gewährleistet werden sollen, hat der Bundesrat den Begriff Vermögensverzicht gesetzlich definiert. Neu ist hierbei, dass der Bundesgesetzgeber jährliche Ausgabengrenzen festgelegt hat. Gibt eine Person mit über CHF 100’000 Vermögen jährlich mehr als 10% ihres Vermögens aus, wird ihr dies als Vermögen weiterhin angerechnet. Bei Personen mit einem Vermögen von unter CHF 100’000 Franken gelten Beträge ab CHF 10’000 pro Jahr als Vermögensverzicht.
Verzicht auf Anrechnung bei «wichtigen Gründen»
Auf die Anrechnung der Ausgaben, die über dem Schwellenwert liegen, kann verzichtet werden, wenn sie aus wichtigen Gründen erfolgen. Es bleibt zu hoffen, dass der Bundesrat diese wichtigen Gründe nicht zu eng definiert. So oder so wird das Privatleben von EL-Gesuchstellenden in Zukunft noch stärker ausgeleuchtet. Erschwerend kommt hinzu, dass nicht nur die letzten Jahre kontrolliert werden, sondern die 10 Jahre vor Beginn des Rentenanspruchs. Dient es tatsächlich der Rechtssicherheit, wenn man sich ab 55 Jahren überlegen muss, ob eine teure Zahnbehandlung oder der Kauf eines Autos später die Existenzsicherung gefährden kann? Zudem ist damit zu rechnen, dass die vermehrte Anrechnung von Vermögensverzichten insbesondere im Heimbereich zu einer Mehrbelastung der Sozialhilfe führen wird.
Reduzierte Leistungen für Familien mit Kindern
Für Kinder unter 11 Jahren wird der anrechenbare Betrag für die Existenzsicherung von CHF 840 auf CHF 590 gesenkt. Bei jedem weiteren Kind wird der Betrag um ein Sechstel gekürzt. Diese Reduktion des Existenzbedarfs wird teilweise durch die höheren angerechneten Mietzinse und die Berücksichtigung der Kinderbetreuungskosten aufgefangen.
Ältere Ausgesteuerte bei der beruflichen Vorsorge bessergestellt
Positiv an der Reform der Ergänzungsleistungen ist eine Gesetzesanpassung betreffend die berufliche Vorsorge. Verliert eine über 58-jährige Person heute ihre Stelle, so scheidet sie automatisch aus der Pensionskasse aus und muss ihr Altersguthaben auf ein Freizügigkeitskonto überweisen lassen. Sie hat im Alter in der Regel keinen Rentenanspruch. Neu kann diese Person in ihrer bisherigen Vorsorgeeinrichtung bleiben und im Alter eine Rente beziehen, wobei sie für die Beiträge selber aufkommen muss, wenn sie das Alterskapital weiter erhöhen möchte.
Abschliessende Betrachtung
Mit der EL-Reform sollten gleichzeitig Kosten eingespart und die Mietzinsmaxima erhöht werden. Es erstaunt daher nicht, dass die Diskussionen sehr kontrovers geführt wurden. Mit dem Ergebnis sind weder der Arbeitgeberverband noch die Behindertenverbände richtig glücklich. Die Unzufriedenheit ist aber derart gleichmässig verteilt, dass weder von rechts noch von links ein Referendum zu erwarten ist. Auch wenn die Reform erst 2021 in Kraft tritt, ist es in der Sozialberatung wichtig, sich bereits jetzt mit den Änderungen auseinanderzusetzen, da eine Intervention von heute sich auf den Anspruch auf EL von morgen auswirken kann.
CAS Sozialhilferecht
Anspruchsabklärungen und Beratung sind Aufgabe der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Der gemeinsam mit der Praxis konzipierte CAS gewährt einen Überblick über das Sozialhilferecht und massgebliche weitere Rechtsgebiete.
CAS Sozialversicherungsrecht
Materielle Ressourcen zu erschliessen, gehört für viele Fachpersonen der Sozialen Arbeit zur Kernaufgabe. Der CAS gibt einen umfassenden Überblick über das geltende Sozialversicherungsrecht.
Dienstleistung und Beratung
Das Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe bietet interessierten Organisationen aus dem Sozialbereich massgeschneiderte Weiterbildungen und Beratung an.
CAS Sozialhilferecht
CAS Sozialversicherungsrecht
Dienstleistung und Beratung
Anspruchsabklärungen und Beratung sind Aufgabe der wirtschaftlichen Sozialhilfe. Der gemeinsam mit der Praxis konzipierte CAS gewährt einen Überblick über das Sozialhilferecht und massgebliche weitere Rechtsgebiete.
Materielle Ressourcen zu erschliessen, gehört für viele Fachpersonen der Sozialen Arbeit zur Kernaufgabe. Der CAS gibt einen umfassenden Überblick über das geltende Sozialversicherungsrecht.
Das Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe bietet interessierten Organisationen aus dem Sozialbereich massgeschneiderte Weiterbildungen und Beratung an.
Kooperation durch Perspektivenwechsel und Positionierung
Schulsozialarbeitende kooperieren mit schulischen Akteuren wie der Schulleitung, Lehrpersonen sowie Fachpersonen der schulischen Heilpädagogik und des Hortes. Zudem sind sie mit Fachstellen vernetzt wie der Sucht- und Gewaltprävention, dem Schulpsychologischen Dienst, der Jugendarbeit, medizinischen und therapeutischen Institutionen sowie Organisationen im Bereich des Kindesschutzes.
Eine gewinnbringende Kooperation bedingt ein vertieftes Verständnis für Ziele und Werte, Prozessabläufe, die aktuelle Praxis, Wissensbestände sowie Kompetenzen der anderen Profession. Aber auch das Artikulieren der eigenen Position und damit das Anbieten der eigenen Expertise und Deutungsmuster sind notwendig. Dabei stellt sich insbesondere die Frage, wie Schulsozialarbeitende ihre eigene professionelle Rolle und Position definieren.
Gewalt als Erziehungsstil
Fast zwei Drittel aller Jugendlichen haben irgendeine Form der elterlichen Gewalt erlebt. Ausschliesslich Züchtigungen wie Ohrfeigen, hartes Anpacken oder Stossen haben 41,4% der Jugendlichen erlebt, schwere Gewalt, wie mit einem Gegenstand oder der Faust schlagen, 21,9%.
Elterliche Gewalt ist eine Erfahrung, die mehr als die Hälfte der Jugendlichen machen mussten – unabhängig davon, welcher sozialen Schicht sie angehören oder ob sie einen Migrationshintergrund haben. Der Anteil gewaltfrei erzogener Jugendlicher liegt bei einheimischen Schweizern bei 42,9%, bei Jugendlichen aus afrikanischen Ländern nur bei 23,1%. Elterliche Gewalt ist Teil der Erziehungskultur der Schweiz, was sich vor allem auch im Vergleich mit Deutschland zeigt: Der Anteil an Jugendlichen mit Gewalterfahrungen liegt in Deutschland um ein Drittel niedriger (40,7% gegenüber 63,3%), was möglicherweise ein Resultat der Einführung des elterlichen Züchtigungsverbots im Jahr 2000 ist.
Profilierung in vier Themenfeldern
Die individuelle Profilbildung fusst auf den aktuellen Themen der vier Institute: «Kindheit, Jugend und Familie», «Delinquenz und Kriminalprävention», «Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe» sowie «Sozialmanagement». Sie ermöglicht Bezüge zur aktuellen Tätigkeit der Studierenden und fördert ihre Laufbahnplanung. Der Fokus auf die Institutsthemen des Departements sorgt für eine enge und vielfältige Verbindung von Forschung und Lehre.
Hintergründe zur Studie
Für die Studie wurden Studierende der Sozialen Arbeit zu ihrer Tätigkeit in der Praxis befragt. Dieses Vorgehen hat den Vorteil, dass Schlüsse zu den Gewaltrisiken in unterschiedlichen Bereichen der Sozialen Arbeit möglich sind. Insgesamt 236 Studierende haben an der Befragung teilgenommen. Der Begriff Gewalt wird im Rahmen der Studie weit gefasst: Neben physischen Formen von Gewalt wie Schlagen, Treten oder Schubsen werden auch verbale Formen von Gewalt wie Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen sowie Gewalt gegen Sachen berücksichtigt.
Die eigene Position fachlich legitimieren
Zur fachlichen Legitimation der eigenen Rolle und Position in der interprofessionellen Zusammenarbeit können verschiedene Quellen dienen: die Konzepte der jeweiligen Trägerschaften zu Schulsozialarbeit, das Leitbild der nationalen Berufsverbände oder die Expertise aus Wissenschaft und Theorie zu Schulsozialarbeit sowie Kinder- und Jugendhilfe. Eine weitere Möglichkeit bietet die Orientierung an der Internationalen Definition Sozialer Arbeit. Wie eine fachliche Positionierung mit der Internationalen Definition (vgl. IFSW) aussehen könnte, wird nachfolgend skizziert.
Ökonomische Sicherheit und Herkunft der Familie sind wichtige Faktoren
Relevante Unterschiede in der Erziehungserfahrung finden sich für zwei Gruppen: Eine ökonomisch problematische Lage geht mit negativeren Erziehungserfahrungen einher. Jugendliche, die selbst bzw. deren Eltern Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe beziehen, berichten doppelt so häufig davon, schwere elterliche Gewalt erlebt zu haben (37,5% gegenüber 19,0%). Eine Erklärung könnte sein, dass die ökonomischen Probleme in diesen Familien häufiger zu Konflikten und Auseinandersetzungen führen, die auch gewalttätig ausgetragen werden.
Ebenso werden Unterschiede bei der Betrachtung verschiedener Herkunftsgruppen deutlich. 10,9% der Jugendlichen ohne Migrationshintergrund berichten vom Erleben schwerer elterlicher Gewalt, bei den Jugendlichen mit Migrationshintergrund liegt dieser Anteil mit 32,1% dreimal so hoch. Es kann daraus gefolgert werden, dass in Migrantenfamilien in der Schweiz häufiger eine Akzeptanz für schwere Gewaltformen als Erziehungsmittel existiert als in einheimischen Schweizer Familien. Allerdings liegt der Anteil Jugendlicher in Schweizer Familien, die Züchtigungen in der Erziehung erlebt haben, ebenfalls hoch: 46,2% gegenüber 36,9% bei Migranten). Elterliche Gewaltanwendung ist damit nicht nur ein Problem in Migrantenfamilien.
Enger Bezug zur Praxis
Der Einbezug der Berufspraxis erfolgt umfassend durch die Zusammenarbeit mit regionalen und lokalen Praxisorganisationen. Kooperationen mit Institutionen im Hochschulraum Zürich und mit internationalen Partnerhochschulen ermöglichen den Studierenden die regionale, nationale und internationale Vernetzung sowie den inter- und transdisziplinären Austausch.
Hoher Anteil an Betroffenen
Da die praktische Erfahrung der Studierenden zum Teil mit einem geringeren Mass an Klientenkontakt verbunden war als für ausgebildete Sozialarbeitende üblich und Studierende mit Gewalterfahrungen eher geneigt sind, an der Umfrage teilzunehmen, kann kein exaktes Bild gezeichnet werden. Es lässt sich jedoch gleichwohl eine Tendenz aufzeigen. Die Befragung ergab, dass mit 76,0 % etwas mehr als drei Viertel der Befragten in den letzten zwölf Monaten Opfer irgendeiner Form von Gewalt durch Klientinnen und Klienten geworden waren. Besonders häufig waren Beleidigungen, Beschimpfungen und Bedrohungen – ein Ergebnis, das sich mit internationalen Studien deckt. Die Befragung zeigte weiter, dass das Risiko, Opfer von Gewalt durch Klientinnen und Klienten zu werden, zunimmt, je häufiger jemand mit Menschen mit Behinderungen oder verhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen zu tun hat.
Lebensbewältigungskompetenz und Wohlbefinden
Die Schulsozialarbeit steht allen Kindern und Jugendlichen der jeweiligen Schuleinheit sowie ihren Bezugspersonen als niederschwelliges, freiwilliges, vertrauliches und unentgeltliches Angebot zur Verfügung. Selbstbestimmung und Mitbestimmung des Gegenübers sind dabei zentrale Prinzipien der Zusammenarbeit. Durch ressourcenorientierte und systemische Beratung fördert die Schulsozialarbeit die Bewältigung psychosozialer Problemstellungen sowie des Schulalltags. Zudem unterstützt sie durch Angebote wie Elternbildung und Elternberatung die Bezugspersonen darin, ihre Verantwortung gegenüber den Kindern und Jugendlichen wahrzunehmen.
Gewalt in der Erziehung bleibt nicht ohne Folgen
Die Analysen betrachten vielfältige Folgen von Gewalt in der Erziehung. Sie reichen von Gewaltverhalten und Sachbeschädigung über Alkohol- und Drogenkonsum bis zu spezifischen Einstellungen wie politischer Deprivation und Extremismus. Elterliche Gewalt, geringe elterliche Kontrolle sowie hohe elterliche Inkonsistenz sind für nahezu alle diese untersuchten Folgen bedeutsam.
Erweiterte Perspektiven
Der Master in Sozialer Arbeit qualifiziert Studierende für komplexe Aufgaben in Praxis und Hochschule und eröffnet Gestaltungs- und (Weiter-)Entwicklungsmöglichkeiten in allen Berufsfeldern der Sozialen Arbeit. Das Studium vermittelt generalistische Kompetenzen, die in allen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit eingesetzt werden können.
Weiterbildungen zum Schutz
Fast zwei Drittel der Befragten gaben an, dass ihre Arbeitgeber Angebote wie Weiterbildungen zum Umgang mit Aggression und Gewalt bereitstellen. Fast die Hälfte der Befragten hatten von diesen Angeboten Gebrauch gemacht.
Soziale Kohäsion
Die Schulsozialarbeit steht für eine Schulkultur ein, welche die Teilhabe und das Wohlbefinden aller Kinder und Jugendlichen gewährleistet. Mit ihren Angeboten fördert sie das informelle soziale Lernen, vermittelt und interveniert bei Konflikten und bezieht die systemischen Aspekte von sozialen Fragestellungen in ihre Überlegungen mit ein.
Weiterführende Informationen
Weitere Informationen
Gewalt als Normalzustand
35,8 % der Befragten sehen Gewalt als Teil des Arbeitsalltags von Sozialarbeitenden. Sie gaben an, sich daran gewöhnt zu haben, dass Klientinnen und Klienten aggressives Verhalten zeigen könnten. Die Ergebnisse der Befragung belegen keinen direkten Zusammenhang zwischen den Gewalterfahrungen einerseits und der Lebenszufriedenheit oder der psychischen Gesundheit der Studierenden andererseits. Die Studierenden haben sich freiwillig für das Studium und die Arbeit mit ihrer Klientel entschieden und kommen anscheinend gut mit den Herausforderungen ihrer Tätigkeit zurecht. Die Kolleginnen und Kollegen sowie die organisationalen Gegebenheiten haben sich die Studierenden hingegen nicht selbst ausgesucht. Es überrascht daher nicht, dass sich Aggressionen unter Kolleginnen und Kollegen sowie die Arbeitsbelastungen negativ auf den sozialen Zusammenhalt und die Lebenszufriedenheit der Studierenden auswirken. Die Befragung macht also deutlich, dass Organisationen gut daran tun, den internen Rahmenbedingungen eine hohe Beachtung zu schenken.
Vermittlung zwischen Individuen und Strukturen
Die Schulsozialarbeit adressiert Strukturen in der Schule, in der Kinder- und Jugendhilfe oder des Sozialraums, die zu Marginalisierung und sozialem Ausschluss führen, und versucht sie zu verbessern. Sie stellt die Anschlussfähigkeit von Schule und Lebenswelt sicher, indem sie die Zusammenarbeit mit zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren wie Vereinen, Stiftungen oder NPOs sowie Institutionen des Gemeinwesens oder der Berufswelt sucht.
Kontakt
Erste Einblicke für die Schweiz
Erste Einblicke in das Thema Gewalterfahrungen von Sozialarbeitenden in der Schweiz machen deutlich, dass dieses Phänomen auch hierzulande keine Seltenheit ist. Durch die Befragung von Studierenden war es möglich, verschiedene Arbeitsbereiche einzubeziehen und so erste Unterschiede und Spezifika herauszuarbeiten. Zukünftige Forschungen könnten diese Perspektive erweitern, indem fertig ausgebildete Sozialarbeitende in einer repräsentativen Stichprobe befragt würden. Dadurch entstünde ein umfassenderes Bild der Verbreitung von Gewalt im Arbeitsalltag von Sozialarbeitenden und entsprechender Folgen.
Berufsethische Werte
Die Frage nach sozialer Gerechtigkeit ist gerade im Bildungssystem omnipräsent. Bildungserfolg und Berufschancen sind nach wie vor in hohem Masse abhängig von sozialen, ökonomischen und kulturellen Faktoren. Schulsozialarbeit hat hier die Aufgabe, sowohl die Lernbedingungen von Schülerinnen und Schülern individuell zu verbessern, als auch auf Möglichkeiten hinzuweisen, wie die Schule sich auf struktureller Ebene weiterentwickeln könnte. Dazu gehört auch, dass sich Schulsozialarbeitende bei der Ausgestaltung ihrer Angebote an den Menschen- und Kinderrechten orientieren und ihre Anspruchsgruppen über diese Rechte informieren.
Kooperation als Kerngeschäft
Die Schulsozialarbeit geht also über die Einzelfallhilfe hinaus, wenn sie sich an der internationalen Definition Sozialer Arbeit orientiert. Ihre Rolle als Vermittlerin an vielfältigen Schnittstellen in den verschiedenen Bereichen der Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen kann sie nur gemeinsam mit anderen Akteurinnen und Akteuren wahrnehmen. Es gilt, mithilfe verschiedener fachlicher Expertisen die Schule als einen sozialen Lern- und Lebensort auszugestalten. Interprofessionelle Kooperation ist daher das anspruchsvolle Kerngeschäft der Schulsozialarbeit, in der sie sich fachlich positionieren muss.
Interessiert an einer Weiterbildung zum Thema Schulsozialarbeit?
Mobiler Spielraum öffnet seine Türen
Im vergangenen September fand der erste Spielnachmittag statt in einer Liegenschaft, welche die AOZ im Auftrag des Sozialamts des Kantons Zürich vorwiegend für Resettlement-Flüchtlinge aus Syrien führt. Der Spielraum hat während der knapp dreimonatigen Pilotphase jeden Sonntagnachmittag von 14 bis 16 Uhr geöffnet und wird von Studierenden und Fachpersonen der ZHAW betreut.
Der sonst anderweitig genutzte Raum wird kurzerhand in einen «Spielraum» umfunktioniert; die im Keller gelagerten Spielsachen und Einrichtungselemente werden hervorgeholt und attraktiv aufgestellt. Die Spielsachen sind einfach und möglichst nicht gekauft: verschieden gefüllte PET-Flaschen, leere WC-Rollen, Bauklötze oder Puzzles. Die Eltern besuchen den Spielraum mit ihren Kindern (bis 6 Jahre) und nutzen ihn auch als Elterncafé, nicht aber als Kinderbetreuung – so die Idee.
Grosse Resonanz, aber anders als erwartet
Das neue Spielangebot kommt gut an. Der Raum ist stets voll. «Die Kinder sind neugierig und erfreut über die Spielmöglichkeiten. Sehr beliebt ist das Malen mit Pinsel und Wasserfarbe», stellt die Studierende Renate Schlatter fest. Es habe sich allerdings auch rasch gezeigt, ergänzt die Projektleiterin Franziska Widmer, dass vor allem die älteren Geschwister die kleinen begleiteten, weniger die Eltern. Die Grossen würden das Spielen genauso geniessen. So seien zu Beginn bis zu 16 Kinder jeden Alters plus Erwachsene gekommen. «Wir mussten am Alter von null bis sechs Jahre festhalten», stellt Franziska Widmer fest. «Wir haben nun eine Mischform – etwas für die ganz Kleinen und auch etwas für die Grösseren.»
Die Teilnahme am Spielnachmittag kann sich auch hinsichtlich eines späteren Krippen- oder Kindergarteneintritts positiv auswirken. «Ich habe bemerkt, dass bei manchen Eltern Bedenken zum Eintritt in diese Einrichtungen reduziert werden konnten», führt die AOZ-Betreuerin Mona Lisa Kathan aus. Sie freue sich ausserdem darüber, wenn sich der sonst triste «Spielraum» sonntags mit viel Farbe, Leben und strahlenden Kinderaugen fülle.
Knackpunkt Elternbegleitung
Gemäss Projektleiterin Franziska Widmer war absehbar, dass die aus fachlicher Sicht wichtige Elternbegleitung der Kleinkinder ein Knackpunkt sein wird. Denn Kleinkinder profitieren mehr vom Angebot, wenn sie durch eine vertraute Person begleitet werden. «Das funktioniert zwar auch mit den grossen Schwestern», sagt Franziska Widmer, «doch die wollen auch etwas – sei es basteln oder Kettchen machen.» Man denke deshalb darüber nach, für die grossen Kinder eine Bastelecke einzurichten.
Die Eltern wurden bisher wenig erreicht. Alle tun sich schwer mit der sprachlichen Verständigung. Aus diesem Grund ist nun ein Elternabend mit Dolmetscherinnen geplant, an dem die Idee des Projekts besser erläutert werden soll. Den Kindern hingegen fällt die Verständigung leicht. «Die meisten sprechen schon ein wenig Deutsch. Ein älteres Mädchen hat auch schon mal für die Kleineren übersetzt, als ich der ganzen Gruppe etwas mitteilen wollte», sagt Renate Schlatter.
Wie weiter?
Das nachhaltige Weiterführen von Angeboten der Integrationsförderung ist der AOZ ein wichtiges Anliegen. Deshalb sucht die AOZ nun in der Standortgemeinde geeignete Freiwillige, welche «Die Kleinen im Zentrum» in Zusammenarbeit mit der ZHAW im nächsten Jahr weiterführen. Interessierte Freiwillige wenden sich bitte per E-Mail an die AOZ Fachstelle Freiwilligenarbeit.
Bezüglich der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention bestehen im Kanton Zürich noch etliche Lücken. Trotz einigen Anstrengungen und guten Beispielen werden die Rechte für Menschen mit Behinderung an vielen Orten nur ungenügend eingehalten. Dies zeigt eine ZHAW-Studie, welche von der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich initiiert und vom Kantonalen Sozialamt finanziert wurde. Im Auftrag der Behindertenkonferenz Kanton Zürich (BKZ) gingen ZHAW-Forschende der Frage nach, wie im Kanton Zürich der Handlungsbedarf aus der Sicht der UNO-Behindertenrechtskonvention ist. «So braucht es beispielsweise dringend Massnahmen zur barrierefreien Kommunikation für Menschen mit Seh- und Hörbehinderung», so ZHAW-Forscherin Sylvie Johner-Kobi vom Departement Soziale Arbeit. Und für eine selbstbestimmte Lebensführung ist eine Systemveränderung der Finanzierung notwendig. Dafür und für viele weitere Massnahmen sind beim Kanton noch keine statistischen Daten und kein Monitoring zu Lebensbedingungen von Menschen mit Behinderung vorhanden.
Welche Unterstützung ist notwendig?
Im Rahmen eines von der Stiftung Mercator Schweiz und von der ZHAW Soziale Arbeit unterstützten partizipativen Forschungs- und Entwicklungsprojekts wurden ehemalige Pflegekinder und Fachpersonen befragt. Dabei wurden das Erfahrungswissen von Fachpersonen sowie die Erfahrungen und Bedürfnisse von (ehemaligen) Pflegekindern erhoben. Die Studie «Übergang in die Selbständigkeit: Pflegekinder wirken mit!» hat gezeigt, dass sowohl die befragten Pflegekinder als auch die Fachpersonen der Kinder- und Jugendhilfe verschiedene Formen von Unterstützung als wichtig erachten. Es wurde deutlich, dass Unterstützung nicht nur durch Fachpersonen erfolgen soll, sondern auch durch ehemalige Pflegekinder, die diesen Übergangsprozess erfolgreich durchlaufen haben. So hätten sich die meisten der befragten ehemaligen Pflegekinder die Unterstützung eine Person mit vergleichbarem Erfahrungshintergrund gewünscht. Basierend auf dieser Erkenntnis wurde unter Mitwirkung von ehemaligen Pflegekindern das Mentoring-Projekt «TAKE OFF» entwickelt.
Verwaltungsstelle und Massnahmenplan gefordert
«Dem Kanton Zürich fehlen zudem ein verbindlicher und überprüfbarer Plan sowie organisatorische Vorkehrungen zur Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention und zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung», so Tarek Naguib von der School of Management and Law der ZHAW. Basierend auf den Studienergebnissen empfehlen die ZHAW-Forschenden deshalb, dass eine kantonale Stelle zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung und Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention gegründet wird. Auch wird ein Entwicklungs- und Massnahmenplan zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung gefordert. Zudem soll die barrierefreie Zugänglichkeit zu Informationen der kantonalen Verwaltung und ihrer Angebote systematisch verbessert werden.
Das Mentoring-Projekt «TAKE OFF»
Grundidee des Projekts ist, dass ehemalige, erwachsene Pflegekinder sich als Mentorinnen und Mentoren engagieren und jüngere Pflegkinder im Übergang in die Selbständigkeit während einer bestimmten Zeit begleiten. Die Mentorinnen und Mentoren werden vom Projektteam der ZHAW auf diese Aufgabe vorbereitet.
Seit 2014 gilt UNO-Behindertenrechtskonvention
Die UNO-Behindertenrechtskonvention (BRK) ist international Anfang Mai 2008 und für die Schweiz am 15. Mai 2014 in Kraft getreten. Die BRK möchte die soziale Benachteiligung von Menschen mit Behinderung verhindern sowie die Teilhabe am bürgerlichen, politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben auf Grundlage der Chancengleichheit fördern. Alle Behörden sind durch ihre verfassungsmässige Zuständigkeit gemäss Art. 1 und 4 der BRK verpflichtet, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für Menschen mit Behinderung zu fördern, zu schützen und zu gewährleisten.
Start im Oktober 2018
Das Mentoring-Projekt «TAKE OFF» kann ab Oktober 2018 von Pflegekindern ab 15 Jahren in Anspruch genommen werden. Die Teilnahme ist für die Pflegekinder freiwillig und kostenlos.
Kontakt für interessierte Pflegekinder
Kennen Sie Pflegekinder, die sich für das Mentoring-Projekt «TAKE OFF» interessieren oder
wünschen Sie weitere Informationen?
Dann können Sie sich gerne an Jessica Wendland wenden oder ihre Kontaktdaten weiterleiten.
E-Mail Jessica Wendland
WhatsApp: 078 675 70 36
Projektteam
Weitere Informationen
Weitere Informationen
Qualität dank Forschung
In der vom Schweizerischen Nationalfonds geförderten Studie «Heimplatzierungen im Kanton Zürich: Einflüsse behördlicher Entscheide zwischen 1950 und 1990 auf den weiteren Lebensverlauf» gehen Thomas Gabriel, Clara Bombach und Samuel Keller unter anderem der Frage nach, welche individuellen Lebensläufe sich nach der Fremdplatzierung ergaben. «Statt dafür zu plädieren, dass Heime abgeschafft werden, muss mehr Wissen darüber generiert werden, wie die Qualität von Heimerziehung verbessert werden kann», so Thomas Gabriel. Die von ihm geleitete Studie leisten einen massgeblichen Beitrag dazu.
Ein Quasiexperiment liefert Antworten
Konkret haben im Rahmen eines Quasiexperiments drei nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Sozialarbeitende 18 Monate lang mit einer reduzierten Fallbelastung gearbeitet: das heisst bei einem Vollzeitarbeitsverhältnis 75 statt rund 145 Fälle. Die übrigen Sozialarbeitenden der Stadt Winterthur bildeten die Kontrollgruppe, sie betreuten wie bis anhin über 145 Fälle.
Wie Zuschreibungen Menschen verändern
Wer für eine gewisse Zeit in einem Waisenhaus, einem Kinder- und Jugendheim oder einem ähnlichen stationären Angebot platziert war, wurde – vor allem aus der Sicht der Erziehenden oder der Aussenstehenden – unweigerlich vom Kind im Heim zum «Heimkind». Dies wird in der Studie der ZHAW «Heimplatzierungen im Kanton Zürich: Einflüsse behördlicher Entscheide zwischen 1950 und 1990 auf den weiteren Lebensverlauf» deutlich. Übergreifend führten solche Zuschreibungen zu Veränderungen in der Eigen- und der Fremdwahrnehmung, zur Einschränkung, aber auch zur Eröffnung von Handlungsspielräumen, zu Erfahrungen der Entmächtigung und manchmal auch der Bemächtigung. Gemeinsam war allen damaligen Kindern und Jugendlichen die Erfahrung, dass sie sich in sehr vielen Situationen nicht als Individuen mit je eigenen Bedürfnissen und Geschichten, sondern als «Heimkinder» wahrgenommen fühlten. Dazu gehörte zumeist, dass sie auf wenige defizitäre Eigenschaften reduziert wurden, die dem einzelnen Kind und Jugendlichen unmöglich gerecht werden konnten. Zudem erlebten sie sich oft als passive Objekte von Entscheidungen und Handlungen der Behörden und Heime und fühlten sich ihnen zunehmend ausgeliefert.
Soziale Arbeit im Kontext Schule
Die Schule ist ein für Kinder und Jugendliche wichtiger Lern- und Lebensraum für fachliches und soziales Lernen. Als gesellschaftliche Institution ist die Schule ständig mit neuen Herausforderungen konfrontiert, unter anderem weil Schülerinnen und Schüler eine immer heterogener werdende Gruppe sind. Dies als Folge von sozialem Wandel und Migration oder veränderten Ansprüchen bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Beruf der Eltern.
Weniger Fälle, tiefere Kosten
Die Studie hat gezeigt, dass eine geringere Fallbelastung tatsächlich tiefere Sozialhilfekosten zur Folge hat. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Sozialarbeitenden die zusätzliche Zeit, die ihnen zur Verfügung steht, für Gespräche mit ihren Klientinnen und Klienten nutzen. Im engeren Austausch konnten individuelle Lösungen gefunden werden, was letztlich eine raschere Verbesserung der Situation der Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger ermöglichte.
Wenn sich die Vergangenheit im Alltag bemerkbar macht
Solche Erfahrungen hatten nachweislich Auswirkungen auf die Ausgestaltung der weiteren Lebenswege dieser Kinder und ihrer Beziehungen zu sich selbst und zu anderen Menschen – auch heute noch, zum Zeitpunkt der mit ihnen geführten Interviews im Rahmen der Studie. Auch wenn sich die Art und Weise der Etikettierung der «Heimkinder» im Lauf der Zeit veränderte, auch wenn sie sich teilweise entschärft zu haben scheint (zum Beispiel dank mehr Unterstützung, Transparenz und Mitbestimmung im Heimalltag), blieb das «Heimkind» oft an ihnen haften. Vielleicht weniger sichtbar und diffuser, aber dennoch häufig lange über den Aufenthalt im Heim hinaus. Das Gefühl, seit Kindheit – sprich seit mehreren Jahrzehnten – nicht von Abhängigkeiten, Vorschriften und Überwachung loszukommen, führt in vielen Fällen zu Frustration und Wut. Andere ehemalige Heimkinder berichten von Gefühlen ohnmächtiger Resignation in einem aussichtslosen, ewigen Kampf gegen ein staatliches Konstrukt. Das kann so weit gehen, dass das grosse, allwissende System als lebenslanger Gegenspieler erfahren wird, der in verschiedenen Lebenssituationen erwartet und unerwartet agiert. Jeder weitere Kontakt beispielsweise mit dem Justizsystem wird dann als Beleg dafür gesehen, dass man auch Jahrzehnte nach dem Heimaustritt nicht als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft akzeptiert und zu Unrecht bestraft wird.
Aktuelle Entwicklungen
Um Kinder und Jugendliche im schulischen Kontext bestmöglich zu fördern, wurden verschiedene Handlungsfelder und Aufgaben der Sozialen Arbeit entwickelt. So hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten die Schulsozialarbeit als niederschwellige Beratungsstelle in der Schule etabliert, und ausserunterrichtliche Förderung und Freizeitgestaltung spielen im Rahmen von Horten und zunehmend auch in Tagesschulen eine immer bedeutendere Rolle. In den letzten Jahren sind vor allem Schulsozialarbeit und Tagesschulen vermehrt in den Fokus des öffentlichen Interesses gerückt. Dabei bestehen innerhalb der deutschsprachigen Schweiz wie auch zwischen Deutschschweiz und Romandie unterschiedliche Bezeichnungen und Modelle von Schulsozialarbeit und Tagesschulen. Daneben existieren weitere Angebote wie sozialpädagogische Kleingruppenschulen oder Familienzimmer, in denen Fachpersonen der Sozialen Arbeit und der Schulpädagogik konzeptionell eng zusammenarbeiten.
Weitere Informationen
Wieso Behörden oder einzelne Menschen als Gegenspieler gesehen werden
Im nachfolgenden Beispiel wird dies deutlich: Jonas wurde nach einem Selbstunfall der Fahrausweis entzogen. Er verlor dadurch das Symbol seiner endlich erreichten Unabhängigkeit nach dem Heimaustritt, was ihn um viele Jahre zurückwarf:
«Der Jugendtraum ist Motorradfahren, schon als Kind. Ich bin eigentlich andauernd Motorrad gefahren, obwohl ich mal einen schweren Unfall hatte. Da haben sie mir dann sechs Jahre den Führerschein weggenommen, weil ich einen Selbstunfall gemacht hatte. Aber die kannten natürlich meine Geschichte, dass es zu Hause scheisse war oder du bist im Heim gewesen oder so, das ist eine schlechte Sache, da kommst du in ein schlechtes Licht. Ja, du bist natürlich nicht so viel wert als uneheliches Heimkind».
Sozial- und rechtsstaatliche Handlungen und Interventionen werden als entmündigende Demütigungen erfahren. Solange dies der Fall ist, werden die ehemaligen Heimkinder bei kritischen Lebensereignissen keine Unterstützungsangebote annehmen können, die Veränderungen möglich machen. Viel eher scheint in solchen Momenten ihre Position als isolierte Aussenseiterin oder isolierter Aussenseiter zementiert zu werden.
Praxis und Forschung in der Schweiz
Der neu erschienene Sammelband gibt erstmals Einblick in Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit im Kontext Schule in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Einerseits präsentieren Vertreterinnen und Vertreter der Praxis in ihren Beiträgen bestehende innovative Projekte, andererseits werden Ergebnisse ausgewählter Forschungsprojekte sowie Diskurse zum Thema vorgestellt.
Was die heutige Praxis daraus lernen kann
Die Qualität und die subjektive Sinngebung der Erinnerung an die erste Intervention spielen eine massgebliche Rolle. Im Falle von bestrafenden Eingriffen nach Jugendstrafrecht – von Strafen bis zu Gerichtsverhandlungen oder Freiheitsentzug – werden die Zementierung ebendieser Position sowie biografisch gefestigte Ohnmachts- und Wuterfahrungen aktualisiert und noch ausgeprägter wahrgenommen. Die heutige Praxis der Kinder- und Jugendhilfe kann dank Einblicken in Biografien nach Heimerziehung viel darüber lernen, wie sie nicht-beabsichtigte Effekte von Unterbringungen und Massnahmen verhindern und im Sinne einer Professionalisierung zusammen mit den jungen Menschen und ihren Bezugssystemen auf sensible Themen angemessener eingehen kann.
Informationen zum Buch
Soziale Arbeit im Kontext Schule
Chiapparini, Emanuela/Stohler, Renate/Bussmann, Esther (Hrsg.)
Budrich-Verlag, 2018
ISBN: 978-3-86388-774-2
Weitere Informationen
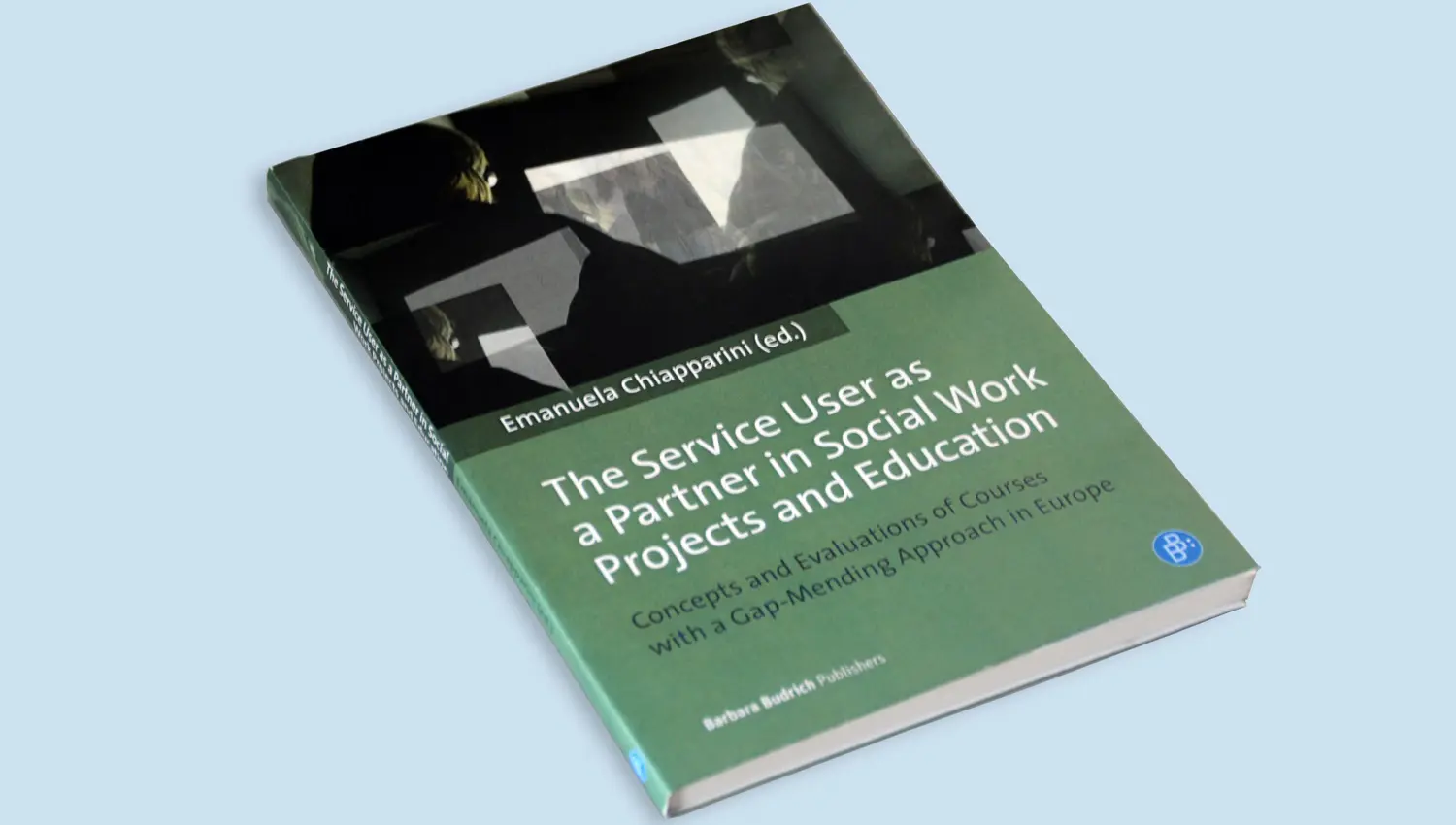
Malin Widerlövs Leben verlief nicht immer geradlinig: So ist die Fremdplatzierung ihres Kindes eine der grossen Herausforderungen, die sie zu bewältigen hatte. In diesem Kontext nahm die Schwedin 2008 an einem Gap-mending-Kurs an der Universität Lund teil. Der Grundgedanke hinter diesen Kursen ist, dass Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit wie Sozialhilfeempfängerinnen und Obdachlose partnerschaftlich in Praxisprojekte und in der Ausbildung der Sozialen Arbeit einbezogen werden, statt lediglich als Informationsquellen zu dienen.
Von der Idee zur Organisation
Während acht Wochen entwickelte Marlin Widerlöv zusammen mit anderen Studierenden sowie Adressatinnen und Adressaten der Sozialen Arbeit ein Projekt, das nach Abschluss des Kurses finanzielle Unterstützung fand. 2013 gründete sie so «Löwenzahn». Die Organisation, die heute 160 Mitglieder zählt, will Mütter und Väter fremdplatzierter Kinder auf der Basis reflektierter Eigenerfahrungen beraten und unterstützen. Fachpersonen der Sozialdienste sowie Vertreterinnen und Vertreter von nationalen NGOs arbeiten eng mit der Organisation zusammen, um die Sichtweise und Bedürfnisse der Betroffenen kennenzulernen und bei Konzeptentwicklungen oder Prozessabläufen zu berücksichtigen
Gap mending: ein transformativer Ansatz
Die transformative Wirkung von gap-mending-Kursen zeichnet sich nicht nur in der Gründung von Betroffenenorganisationen oder der Umsetzung von nachhaltigen Projekten ab: Auch in der nachhaltigen Veränderung der eigenen Haltung gegenüber Adressatinnen und Adressaten sowie zukünftigen Fachpersonen der Sozialen Arbeit wird sie sichtbar.
Der Gap-mending-Ansatz in Europa in Theorie und Praxis
Im von Emanuela Chiapparini herausgegebenen Sammelband «The Service User as a Partner in Social Work Projects and Education» stellen Autorinnen und Autoren Konzepte, Durchführungen und Evaluationen ihrer Kurse und Projekte mit dem Gap-Mending-Ansatz vor. Vertreten sind die Länder Schweden, Norwegen, England, Dänemark, Deutschland und die Schweiz. Das Vorwort stammt von der «Löwenzahn»-Gründerin Malin Widerlöv. Die Herausgeberin gibt eine Einführung in den Gap-mending-Ansatz und skizziert dessen theoretische Einbettung mit Blick auf das Thema «User Involvement». Dieses einzigartige Buch gibt zum ersten Mal einen theorie- und praxisorientierten Überblick über den Gap-mending-Ansatz.
Chiapparini, Emanuela (Hrsg.)
The Service User as a Partner in Social Work Projects and Education.
Concepts and Evaluations of Courses with a Gap-mending Approach in Europe.
ISBN 978-3-8474-0507-8
140 Seiten, in englischer Sprache
Verlag Barbara Budrich, 2016

Als Dozent im Institut für Sozialmanagement leitet Michael Herzig einerseits den CAS Finanzen und Marketing, andererseits unterstützt er soziale Organisationen in der Strategie-, Qualitäts- oder Angebotsentwicklung und in betriebswirtschaftlichen Fragen. Vor seiner Tätigkeit an der ZHAW leitete der gebürtige Berner Einrichtungen für Drogen- und Alkoholabhängige, psychisch Kranke, Langzeitarbeitslose und Sexarbeiterinnen im Sozialdepartement der Stadt Zürich. 2007 veröffentlichte Michael Herzig seinen ersten Kriminalroman, danach folgten Kurzgeschichten, weitere Krimis und zuletzt ein Episodenroman.
Michael Herzig, hatte sich Ihre Berufswahl schon immer abgezeichnet oder hätten Sie sich auch eine ganz andere Laufbahn vorstellen können?
Zuerst wollte ich Matrose werden, dann Koch, Schriftsteller, Filmregisseur und schliesslich Musiker. Geschichte habe ich eigentlich nur studiert, weil mir dieses Studium damals viel Zeit liess für meine Tätigkeit als Musiker.
Wie kam es, dass Sie am Ende im Sozialbereich gelandet sind?
In den Sozialbereich bin ich irgendwie hineingerutscht, und mit der Zeit hat sich ein Feuer für diese Branche in mir entfacht, das ich kaum mehr löschen kann.
Was reizt Sie am meisten an Ihrer heutigen Tätigkeit?
Mit meiner Teilzeitstelle als Dozent kann ich meine verschiedenen Passionen ausleben. Das Feuer für den Sozialbereich lodert weiter, gleichzeitig schreibe ich Romane, die ab und zu sogar gelesen werden, und – wenn alles gut geht – bald auch ein Drehbuch. Mit der Musik habe ich sowieso nie aufgehört.
Was war das grösste Aha-Erlebnis Ihrer beruflichen Laufbahn?
Als ich Drogenbeauftragter der Stadt Zürich geworden bin, habe ich in einem Fixerstübli einen alten Bekannten aus meiner Jugend in Bern angetroffen – als Klient, nicht als Betreuer. Da habe ich verstanden, was kulturelles Kapital ist.
Wie gelingt Ihnen privat der Ausgleich zu Ihrer Berufstätigkeit?
Ich trenne nicht zwischen Beruf und Hobby, sondern mache viele verschiedene Dinge extrem gerne und habe dazu glücklicherweise auch unterschiedliche Fähigkeiten, von denen einige stärker nachgefragt werden als andere. Für mich persönlich ist der Mix entscheidend.
Jugendliche testen gerne ihre eigenen Grenzen – sei es beispielsweise bei riskanten sportlichen Aktivitäten oder beim Alkohol- und Drogenkonsum. Jugendliche testen aber auch gerne die Grenzen, die durch gesellschaftliche Normen gesetzt werden. Die Rebellion gegen die Erwachsenenwelt findet in der Affinität zu politisch extremen Positionen eine Ausdrucksform unter vielen. Die Geschichte zeigt unter anderem anhand der 68er-Bewegung, dass extreme Überzeugungen bei jungen Menschen schnell Anklang finden, ihr Handeln kann dann eine Veränderung der Gesellschaft herbeiführen. So dürften die Jugendproteste in den 80er-Jahre in mehreren Schweizer Städten mit dem Ruf nach mehr (autonomen) Freiräumen für die Jugend sowie die Wohnungsnot-Bewegung in den 90er-Jahren durch eine ausgeprägte linke Orientierung bei vielen jungen Menschen zu erklären sein. Auch daraufhin hat sich die Gesellschaft der Schweiz verändert.
Extremismus im Jugendalter wird allerdings nur selten mit etwas Positivem in Zusammenhang gebracht. Er löst im Gegenteil regelmässig Sorgen aus, wird als Gefahr eingestuft: als Gefahr für die Entwicklung der Jugendlichen selbst, aber auch für Dritte. Derzeit wird eine solche Gefahr insbesondere mit Blick auf den islamischen Extremismus wahrgenommen. Terroristische Anschläge in Europa wie am 13. November 2015 in Paris und am 22. März 2016 in Brüssel haben zu weltweiter Empörung geführt sowie zur Besorgnis und Verängstigung beigetragen. In der Schweiz hat es solche Anschläge bislang nicht gegeben. So genannte Jihadreisende, die sich aus der Schweiz aufmachen, um im syrischen Bürgerkrieg auf der Seite des IS mitzukämpfen, sowie sich radikalisierende muslimische Jugendliche in Schweizer Städten sind jedoch Thema in den Medien, aber auch für die Soziale Arbeit.
Als «extrem» gelten jene Positionen, die die Demokratie ablehnen und sie – auch unter Anwendung von Gewalt – überwinden möchten. Der Rechtsextremismus negiert dabei das Prinzip der Gleichheit aller Menschen: Fremdenfeindlichkeit und Nationalismus bilden seine wesentlichen Kernelemente. Der Linksextremismus ist demgegenüber antikapitalistisch, antifaschistisch und antimilitaristisch ausgerichtet und zielt ebenfalls auf die Überwindung des Staates und dessen Ersetzung durch die Anarchie ab. Ziel des islamischen Extremismus ist die Errichtung eines islamischen Gottesstaats, in dem die Grundrechte keine Geltung mehr besitzen.
Aktuell relevante Extremismen
Verlässliche Zahlen zur Verbreitung von Extremismus im Jugendalter gibt es nicht. Hierfür wären repräsentative Befragungsstudien notwendig. Denn wie bei negativen Phänomenen allgemein gilt auch beim Extremismus: Nur ein kleiner Teil der Taten wird polizeilich registriert und damit erfasst. Laut dem Bericht «Sicherheit Schweiz 2015» ist im Bereich des Linksextremismus in der Schweiz eine hohe Aktivität zu verzeichnen. 2014 wurden 218 Fälle von gewaltsamen Ereignissen registriert, dies bei seit 2010 leicht rückläufiger Tendenz. Beim Rechtsextremismus lag die Fallzahl 2014 bei 19: Im Vergleich zu 2010 hat sie sich mehr als halbiert. Inwieweit Jugendliche in diese Taten involviert waren, geht aus dem Bericht nicht hervor. Studien aus Deutschland belegen aber, dass gerade im Bereich des rechts- wie linksextremen Verhaltens eine hohe Beteiligung von Jugendlichen festzustellen ist. Zum Jihadismus beziehungsweise islamischen Extremismus sind Anfang 2016 bereits 72 Fälle von jihadistisch motivierten Reisenden in Konfliktgebiete bekannt, Zahlen zu islamisch extremistischen Taten liegen jedoch nicht vor. Eine Studie des Departements Soziale Arbeit der ZHAW zeigt, dass die meisten Jihadreisenden zwischen 24 und 35 Jahre alt sind, so dass man eher von einem Erwachsenen- als von einem Jugendphänomen sprechen muss.
Ursachen der Zuwendung zum Extremismus
Für viele Jugendliche dürfte die Ideologie von eher untergeordneter Relevanz dafür sein, sich einem Extremismus zuzuwenden. Sicher gibt es Jugendliche, die bewusst aufgrund ideologischer Überzeugungen den Anschluss daran suchen. Meist dürften es aber individuelle und soziale Bedingungsfaktoren sein, die Jugendliche anfällig dafür machen. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass es Extremismus übergreifende Bedingungsfaktoren gibt, wie Ergebnisse einer Studie unter Beteiligung des Departements Soziale Arbeit der ZHAW zeigen. So stellen Extremismen beispielsweise ein attraktives Identitätsangebot dar. Gerade Jugendliche, die sich in ihrer Identität unsicher sind, erhalten dadurch ein festes Weltbild und eine feste Identität. Im Prozess der Zuwendung zum Extremismus kommt den sozialen Medien eine immer wichtigere Rolle zu: Jugendliche greifen bei ihrer Suche nach Identitätsangeboten und Zugehörigkeiten auf das Internet zurück. Vertreter verschiedener Extremismen stellen entsprechend für Jugendliche attraktive Angebote ins Netz.
Daneben konnten in Studien weitere Faktoren identifiziert werden: Wenn sich Jugendliche von zentralen gesellschaftlichen Institutionen wie der Schule, der Polizei oder der Justiz ungerecht behandelt fühlen oder wenn sie generell risikoaffin sind, ist die Zuwendung zum Extremismus wahrscheinlicher. Die Extremismen ermöglichen einerseits eine Abwendung von «ungerechten» Institutionen, andererseits versprechen sie Abenteuer und Action.
Eine bislang wenig untersuchte Frage ist, wie es vor dem Hintergrund ähnlicher Bedingungsfaktoren dazu kommt, dass sich manche Jugendliche eher nach rechts, andere nach links orientieren und dritte wiederum den islamischen Extremismus attraktiv finden. Eine mögliche Antwort könnte im Umfeld der Jugendlichen zu suchen sein: Das Umfeld in Form der Familie, der Freundesgruppe oder der Vereins- und Freizeitmöglichkeiten in der Nachbarschaft gibt bestimmte Alternativen vor. Jugendliche schliessen sich möglicherweise deshalb dem Rechtsextremismus an, weil es vor Ort eine entsprechende Gruppierung gibt. Solche Umfeldfaktoren müssen jedoch immer auch mit den jeweils individuellen Problemdeutungen und Weltanschauungen, Identitäts- und Zugehörigkeitsfragen, diskriminierenden Erfahrungen oder Opfererfahrungen zusammenspielen.
Was kann die Soziale Arbeit leisten?
Die Soziale Arbeit verfügt über ein ausgeprägtes Wissen und vielfältige Zugänge zur Arbeit mit radikalisierten Jugendlichen. Sie kann sowohl auf individueller als auch auf gesellschaftlicher Ebene Prävention und Interventionen initiieren und gemeinsam mit weiteren Akteuren umsetzen. Ihr kommt damit eine Hauptaufgabe bei der Arbeit mit extremismusaffinen Jugendlichen zu. Dabei verfolgt sie stets eine mehrperspektivische Sicht auf die Extremismusproblematik, die nicht das Individuum in einer defizitorientierten oder gar pathologisierenden Sicht ins Zentrum stellt, sondern vielmehr die sozialen, gesellschaftlichen und politischen Zusammenhänge in Betracht zieht, um der Komplexität des Zusammenwirkens unterschiedlicher Einflüsse gerecht zu werden.
Die Soziale Arbeit berät und unterstützt alle jugendrelevanten Akteure wie Schule, Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Gemeinwesenarbeit und Vereine bei der Früherkennung von Radikalisierungen sowie beim Umgang mit betroffenen Jugendlichen. Die ZHAW bietet diesbezüglich auch Weiterbildungen an. Bei Jugendlichen, die extremistischen Gruppierungen angehören oder eine extremistische Identität aufgebaut haben, ist eine intensive Ausstiegs- bzw. Deradikalisierungsarbeit nötig – hierfür stellt die Soziale Arbeit Wissen, Zugänge sowie konkrete Interventionsansätze zur Verfügung. Notwendig ist in solch einer Situation eine intensive Arbeit mit den Jugendlichen selbst sowie mit ihrem Umfeld (Eltern, Lehrkräfte, Freunde und gegebenenfalls Polizei).
Hinsichtlich der Prävention von Radikalisierung sei gesagt, dass generell die durch Soziale Arbeit geleistete Jugendarbeit im Sinne der Gemeinwesenarbeit, der organisierten Freizeitgestaltung und der aufsuchenden Jugendarbeit einen wichtigen Beitrag leistet. Dort, wo es der Sozialen Arbeit gelingt, die Jugendlichen zu erreichen, ihre Probleme und Sorgen zu erfassen und ernst zu nehmen und ihnen bei der Identitätssuche unterstützend zur Seite zu stehen, wird neben anderen positiven Entwicklungen auch der Radikalisierung vorgebeugt.
Die Soziale Arbeit leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Prävention von und Intervention bei Extremismus. Sicherlich besteht jedoch noch Entwicklungsbedarf. Die Jugend ist eine dynamische Lebensphase, die auch Anpassungen auf Seiten der Sozialen Arbeit notwendig macht. Derzeit gelingt es zum Beispiel noch nicht, schweizweit Angebote für muslimische Jugendliche zur Verfügung zu stellen. Neben der geografischen Breite stellt die Radikalisierung über das Internet eine weitere bedeutsame Herausforderung dar, für die die Soziale Arbeit kreative und effektive Lösungen wird finden müssen.
Literaturverweise
- Baier, D. u.a. (2016). Einflussfaktoren des politischen Extremismus im Jugendalter. Rechtsextremismus, Linksextremismus und islamischer Extremismus im Vergleich.
- Eser Davolio, M. u.a. (2015). Hintergründe jihadistischer Radikalisierung in der Schweiz. Eine explorative Studie mit Empfehlungen für Prävention und Intervention. ZHAW.
Tagesschulen müssen gleichzeitig unterschiedlichen Bedürfnissen aus Politik und Gesellschaft gerecht werden: Sie sollen Kinder ganzheitlich fördern, Eltern bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie entlasten und nicht zuletzt Kosten senken. Gerade auch bei Alleinerziehenden soll dies zu mehr Chancengleichheit führen. In der Stadt Zürich werden deshalb im Rahmen des Projekts «Tagesschulen 2025»
flächendeckend gebundene Tagesschulen eingeführt. Fünf Pilotschulen starten ihren Betrieb im August 2016.
Schweiz mit Nachholbedarf
In den USA und in zahlreichen OECD-Ländern gehören Tagesschulen bereits zum Alltag, in der Schweiz befinden sie sich aber erst im Aufbau. So wurde auch der Bildungs- und Erziehungsauftrag der an Tagesschulen Tätigen hierzulande erst wenig differenziert untersucht. Mit dem komplexen Thema der pädagogischen Zuständigkeiten an diesen Schulen befasst sich nun ein Forschungsprojekt der ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften und der PHZH Pädagogischen Hochschule Zürich.
Das vom Schweizerischen Nationalfonds SNF geförderte Projekt «AusTEr – pädagogische Zuständigkeiten an Tagesschulen im Spannungsfeld öffentlicher Erziehung» wird von Mai 2016 bis Oktober 2018 durchgeführt. Im Zentrum steht die Frage, wie multiprofessionelle Teams und Erziehungsbeauftragte an Tagesschulen die pädagogischen Zuständigkeiten aushandeln. «Von den Eltern über die verschiedenen Lehr- und Betreuungspersonen bis zur Schulleitung – bei so vielen Beteiligten ist die Notwendigkeit zur Koordination gross», weiss Patricia Schuler, Projektleiterin für die PH Zürich.
Zusammenspiel vieler Beteiligter verstehen
Im Projekt geht es darum zu verstehen, wie die verschiedenen Beteiligten die pädagogischen Zuständigkeiten aushandeln und welches die Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Aufgaben sind. «Zum Beispiel geht es darum zu klären, wie Lehr- und Betreuungspersonen, Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Eltern oder auch ausserschulische Drittanbieter wie Sportvereine für die soziale Entwicklung der Heranwachsenden verantwortlich sein können», so ZHAW-Projektleiterin Emanuela Chiapparini. Erst dann zeigt sich, welche Art von Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten sinnvoll und erfolgsversprechend ist.
Für die Studie werden vier Tagesschulen vor und nach ihrer Einführung analysiert und miteinander verglichen, um Optimierungspotenzial zu eruieren. Dazu werden Interviews mit den involvierten Fachpersonen sowie mit Schülerinnen und Schülern und deren Erziehungsbeauftragten geführt. Auf der Basis der ausgewerteten Interviews werden schliesslich differenzierte Orientierungsmuster ausgearbeitet.
Weitere Informationen
www.zhaw.ch/sozialearbeit/auster
Kontakt
ZHAW, Departement Soziale Arbeit
Dr. Emanuela Chiapparini
Telefon 058 934 89 54
emanuela.chiapparini@zhaw.ch
PHZH
Prof. Dr. Patricia Schuler
Telefon 043 305 59 16
patricia.schuler@phzh.ch
Medienstelle
ZHAW Corporate Communications
Telefon 058 934 75 75
medien@zhaw.ch
Pflege vs. Hilfe im Haushalt und Betreuung
Das Beispiel zeigt, wie schwer und für den Laien abstrakt die Unterscheidung zwischen von der Krankenversicherung anerkannten Pflegeleistungen und Hilfe im Haushalt ist. Insbesondere im fortgeschrittenen, sogenannten vierten Alter verstärkt sich diese Problematik, wenn eine Person neben der medizinischen Pflege auf weitere Hilfe und Unterstützung angewiesen ist, um ihren Alltag so lange wie gewünscht in den eigenen vier Wänden bestreiten zu können. Von den 80- bis 84-Jährigen sind heute rund 13 Prozent pflegebedürftig, von den über 85-Jährigen sind es bereits gut 34 Prozent. Da in aller Regel mit der Pflegebedürftigkeit eine Hilfsbedürftigkeit einhergeht und eine Hilfsbedürftigkeit einer Pflegebedürftigkeit vorausgeht, dürfte der Gesamtbedarf an Unterstützung von fragilen Menschen im Alter noch deutlich höher ausfallen, als es diese Zahlen ausweisen.
Im Gegensatz zur medizinischen Pflege ist der Begriff «Betreuung» in der schweizerischen Gesetzgebung nicht geregelt. Betreuung scheint sich vor allem dadurch auszuzeichnen, dass sie all das umfasst, was medizinische Pflege nicht ist. Dies entspricht jedoch einer einseitigen Unterscheidungslogik, die in erster Linie auf die unterschiedlichen Finanzierungsmodi zurückzuführen ist: Während die Grundversicherung der obligatorischen Krankenversicherung in der Schweiz für die Finanzierung von ärztlich erbrachten oder angeordneten Leistungen aufkommen muss (exklusive Franchise und Selbstbehalt), sind die nichtmedizinischen Leistungen in aller Regel von den Leistungsbeziehenden selber zu finanzieren. Nur bei bedürftigen Rentnerinnen und Rentnern werden medizinisch indizierte Betreuungskosten von der öffentlichen Hand übernommen, dies im Rahmen der Ergänzungsleistungen zur AHV/IV oder zu kantonalen Bedarfsleistungen, wobei die konkrete Handhabung kantonal geregelt ist.
«Zusammen alleine»
Das Buch mit dem Titel «Zusammen alleine – Alltag in Winterthurer Kinder- und Jugendheimen 1950–1990» ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. Die ehemaligen Heimkinder kommen darin anhand zahlreicher Zitate aus Interviews zu Wort. Ergänzt werden ihre Perspektiven durch Berichte früherer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Heimerziehung in Winterthur wird zudem anhand von Archiv- und Bildmaterial dargestellt. Um aus der Geschichte zu lernen, wünschte die Auftraggeberin, die Stadt Winterthur, ausdrücklich keine Heile-Welt-Darstellung, die schwierige Kapitel ausklammert.
Nicolas Galladé, Stadtrat von Winterthur und Vorsteher des Departements Soziales, bezeichnet das Buch als «eindrückliches Zeugnis über den Winterthurer Heimalltag». Dass die ehemaligen Heimkinder von weit zurückliegenden Erlebnissen berichten, als ob sie gestern geschehen wären, wertet er als Zeichen dafür, wie einschneidend und prägend diese waren.
Downloads
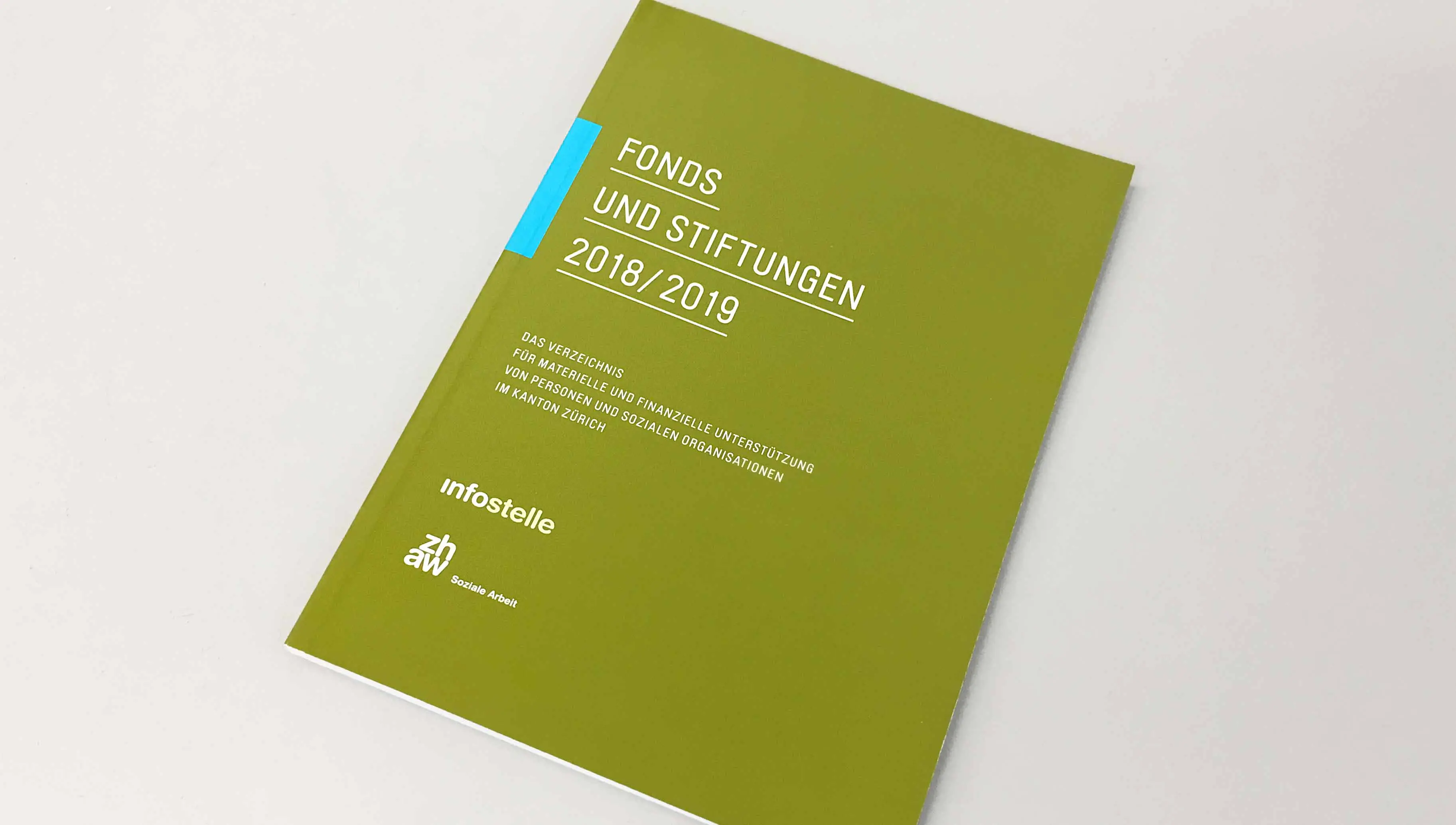
Wo erhalten betagte Menschen oder Menschen mit Behinderung dringend benötigte Unterstützungsbeiträge? Wer hilft, die Zahnarztrechnung der Kinder zu bezahlen? Und welche Ausbildungsstipendien gibt es? Für Antragstellende ist es oft nicht einfach, mit ihrem Gesuch an die richtige Adresse zu gelangen.
Das Verzeichnis «Fonds und Stiftungen 2018/2019» gibt einen hilfreichen Überblick über die gemeinnützigen Institutionen im Kanton Zürich. Herausgegeben wird das Verzeichnis alle zwei Jahre von der Infostelle, einer Dienstleistung des Departements Soziale Arbeit der ZHAW. Es erscheint Ende Dezember 2017 bereits in der 26. Auflage und umfasst rund 190 Einträge.
Jeder Adresseintrag enthält eine genaue Beschreibung des Stiftungszwecks, die Gesuchadresse und eine Aufstellung der erforderlichen Beilagen sowie Einreichungstermine und Zielgruppen. Ausserdem wird deklariert, wer als Gesuchsteller infrage kommt. Eine Übersichtstabelle hilft bei der Suche nach der richtigen Stiftung. Hier sind Zielgruppen, Gesuchstellende und Auslastung pro Eintrag aufgeführt. Das Verzeichnis enthält zudem zahlreiche Tipps, wie Gesuche erfolgreich zu stellen sind.
Den verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildungsfinanzierung, alternativen Formen von Unterstützung wie Crowdfunding sowie den neuen Tauschformen der Sharing Economy ist je ein separates Kapitel gewidmet.
Interessiert an einer Weiterbildung?
Weitere Informationen
Aufbruch
Bei der ersten Befragung mit durchschnittlich 16 Jahren ist eine Grundstimmung des Aufbruchs deutlich wahrnehmbar. Die Eltern waren ausgewandert, um den Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen – die geografische Mobilität sollte eine soziale Mobilität der Kinder zur Folge haben. Die Auswanderung wurde so zum Familienprojekt, das zusammenschweisst und in den Jugendlichen einen deutlichen Aufstiegswillen weckt. Ein Aufstiegswille, der sich zu jenem Zeitpunkt vor allem im dominierenden Thema, der Lehrstellensuche, äussert.
Unterstützen Sie das Projekt!
Weitere Informationen zum Projekt und zu den Möglichkeiten der Unterstützung erfahren Sie auf der Crowdfunding-Plattform «wemakeit».
Aktuelle Entwicklungen und dringliche Fragen
Ein Hilfs- und Pflegebedarf beginnt in der Regel an der Schwelle vom sogenannten dritten zum vierten Alter. Obschon sich der Hilfs- und Pflegebedarf nicht linear zur steigenden Lebenserwartung entwickelt, ist von einem anhaltenden Trend hin zu mehr Hilfs-, Betreuungs- und Pflegeleistungen auszugehen. Aufgrund der Individualisierung nimmt die Zahl der Einzelhaushalte zu. Fragen der Vereinzelung und der sozialen Isolation im Alter akzentuieren sich insbesondere dann, wenn das soziale Netz zunehmend brüchig wird und Handlungsfähigkeit und Mobilität aus gesundheitlichen Gründen eingeschränkt werden. Aufgrund der zunehmenden Erwerbstätigkeit von Frauen stellt sich die Frage, wer künftig – an Stelle oder in Ergänzung zu den Partnerinnen und Töchtern – in die Bresche springt bezüglich der informellen, nichtmedizinischen Care-Arbeit bei älteren Angehörigen. Global gesehen werden wir zudem gefordert sein, Hilfs- und Pflegearrangements im Rahmen der sogenannten Care-Migration sozialgerechter und sozialverträglicher zu gestalten. Verbesserte Rahmenbedingungen für betreuende und pflegende Angehörige und Care-Migrantinnen sind zwar notwendig, aber nicht hinreichend. Was geschieht beispielsweise mit älteren Menschen, die über kein familiäres Netz verfügen und sich keine Betreuung zu Hause leisten können? Welche Voraussetzungen sind nötig, damit vermehrt auch Männer in die informelle Hilfe und Betreuung einbezogen werden können? Hier bräuchte es eine gesellschaftliche Auseinandersetzung und Verständigung darüber, welche Modelle der Hilfe, Betreuung und Pflege im Alter wir wollen, wer die Leistungen vorwiegend oder in welchem Umfang unter welchen Rahmenbedingungen zu erbringen hat – Fachkräfte oder Familie – und wie die Leistungen zu finanzieren sind: kollektiv-solidarisch oder privat-individuell.
Weitere Informationen
Forschungsprojekt Winterthurer Kinderheime – Heimalltag im Spiegel von Erlebnisberichten Medienmitteilung der Stadt Winterthur zur Buchpräsentation Artikel im Landboten «Zusammen und doch allein – so empfanden Heimkinder ihr Sein» Audio-Interview SRF «Musische und sportliche Förderung, aber auch sexueller Missbrauch»
Ansprechpersonen
Fonds und Stiftungen bestellen
Weiterführende Informationen
Ernüchterung
Drei Jahre später ist die Lust am Aufbruch einem Gefühl der Ernüchterung gewichen. Vielen gelang es trotz hohem Engagement nicht, eine Lehre in ihrem Wunschberuf zu machen: Sie mussten auf eine Zwischenlösung ausweichen und fanden schliesslich in jenen Berufen und Branchen einen Ausbildungsplatz, die wenig beliebt sind. Der Einstieg ins Berufsleben wird denn auch als fremdbestimmt wahrgenommen. Die vielfältigen Beziehungen aus der Volksschule verlieren sich, im Freizeit- und Berufsleben dominieren Kontakte zu Personen derselben Herkunft. Gescheiterte und aus Angst vor Ablehnung zurückgezogene Einbürgerungsbegehren sind ein Thema. Der Glaube an ein meritokratisches Gerechtigkeitsversprechen wird durch gegensätzliche eigene Erfahrungen getrübt. In manchen Fällen zieht dies eine Distanzierung vom Familienprojekt des sozialen Aufstiegs nach sich.
Wer soll das bezahlen?
Gemäss Hochrechnungen des Bundesrates werden sich die Ausgaben für die Langzeitpflege von rund 6 Milliarden Franken im Jahr 2011 bis 2045 auf rund 18 Milliarden Franken verdreifachen. Die Hauptbetroffenen dieses Anstiegs werden die Kantone, die Gemeinden und die privaten Haushalte sein. In seinem jüngsten Bericht zur Langzeitpflege skizziert der Bundesrat verschiedene Varianten, wie die zu erwartenden Mehrkosten zu finanzieren sind – wobei hier indirekt auch die Systemfrage gestellt wird: nämlich die Frage, wie künftig im Alter umsorgt und gepflegt werden soll und nach welchen Kriterien diese Leistungen abgegolten werden. Die Vorschläge reichen von einer Pflegeversicherung zur Abdeckung der Betreuungskosten über eine Versicherung, bei der nur die Pflegeleistungen der obligatorischen Krankenpflegeversicherung abgedeckt werden, bis zu einer umfassenden Versicherungslösung.
Sozialpolitisch relevant ist dabei nicht nur, welche Hilfs-, Betreuungs- und Pflegearten konkret durch eine allfällige neue Versicherung abgedeckt würden. Es muss auch geklärt werden, ob es sich um eine privatrechtliche Lösung – wie etwa die Ausweitung der Säule 3a zur Deckung der Pflegekosten – oder um ein öffentlich-rechtliches Modell handelt – wie etwa die Ausweitung der obligatorischen Krankenpflegeversicherung respektive die Schaffung einer eigentlichen Pflegeversicherung –, und wie viele öffentliche Beiträge oder Mittel vorgesehen sind. Schlussendlich geht es bei der Wahl der Finanzierung nicht nur darum, wer die Kosten trägt, sondern auch darum, welche horizontale oder vertikale Umverteilung daraus resultiert. Wird das Erbe mit einer Pflegeversicherung geschützt oder werden die Kantone und Gemeinden zulasten der Prämienzahlenden geschont, so führt dies zu einer Umverteilung zuungunsten der weniger wohlhabenden Bevölkerung. Lässt man das System der Finanzierung der Krankenkassenprämien über Kopfprämien unverändert, so führen der demografische Wandel und das Kostenwachstum im Gesundheitswesen zu einer zunehmenden Lastenverschiebung zum Nachteil der jüngeren Bevölkerung. Zusätzlich verschärft wird diese Entwicklung durch sinkende individuelle Prämienverbilligungen der Kantone. Unabhängig davon bleibt zu überlegen, warum nicht für einmal das Rad der Geschichte zurückgedreht werden soll und Pflege unabhängig davon, ob sie im Spital, in einem Alters- und Pflegeheim oder durch die Spitex erbracht wird, von der Krankenversicherung abzudecken ist. Weiter wäre die in der Praxis ohnehin als problematisch erachtete Unterscheidung von Betreuung und Pflege aufzuheben respektive eine für das Alter eigenständige, neue und umfassende Definition der Hilfslosigkeit im Alter inklusive Pflegebedürftigkeit zu schaffen, die an die Umschreibung der Grundpflege in Artikel 7 der Krankenpflege-Leistungsverordnung anschliesst. Die Soziale Arbeit wird sich in Zukunft zudem mit zwei weiteren Fragen beschäftigen: Ist ein ausreichendes und qualitativ hochstehendes Hilfs-, Betreuungs- und Pflegeangebot auch für vulnerable Menschen im Alter zugänglich und erschwinglich? Und welche Massnahmen sind allenfalls notwendig für die Sicherstellung und Optimierung eines bedarfsgerechten und lückenlosen Betreuungsangebots?
Zusammen alleine - Alltag in Winterthurer Kinder- und Jugendheimen 1950–1990
Clara Bombach, Thomas Gabriel, Samuel Keller, Nadja Ramsauer, Alessandra Staiger Marx,
Stadtbibliothek Winterthur
Chronos Verlag Zürich, 2017
ISBN 978-3-0340-1430-9
Fonds und Stiftungen 2018/2019
Das Verzeichnis für materielle und finanzielle Unterstützung von Personen und sozialen Organisationen im Kanton Zürich
Infostelle (Hrsg.)
2017
CHF 35.00
Durchhalten
Mit 26 Jahren sind den Interviewten vor allem zwei Dinge gemeinsam: die hohe Leistungsbereitschaft und die Anpassungsfähigkeit, mit denen sie sich auf dem Arbeitsmarkt bewegen und zu behaupten versuchen. Auftrieb gibt den jungen Erwachsenen in dieser Phase das erworbene Berufszertifikat. Dadurch gewinnen sie an Ermächtigung und Zugängen zum Arbeitsmarkt, wo in erster Linie ihre Qualifikation und weniger ihre Herkunft zählt. Manchen gelingt schrittweise ein sozialer Aufstieg, andere kämpfen nach wie vor darum, aus der ökonomischen Prekarität herauszufinden. In beiden Situationen sind Erschöpfung und Überforderung zu beobachten, verbunden mit einem anhaltend starken Durchhaltewillen. Gegenseitige Unterstützung in der Familie wird grossgeschrieben. Damit werden gerade in Situationen finanzieller Knappheit die familiären Beziehungen wieder enger. Während Erfahrungen von Stigmatisierung im alltäglichen sozialen Kontakt abnehmen, ist indirekter Rassismus vor allem bei Jugendlichen aus dem ehemaligen Jugoslawien ein Thema, Verletzung durch öffentliche und mediale Diskurse betreffen überwiegend junge Musliminnen und Muslime. Gemäss Nina Gilgen, Kanton Zürich, muss die Bekämpfung von Diskriminierung ein Schwerpunkt sein: Im Kanton Zürich ist dieser gesetzt. «Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass verstärkt auf struktureller Ebene gearbeitet werden muss», findet die Leiterin der Fachstelle für Integrationsfragen.
Verantwortlich für das Projekt
Forschung und Weiterbildung
Die ZHAW Soziale Arbeit beschäftigt sich in Forschung und Weiterbildung verschiedentlich mit Betreuung und Pflegeaspekten und arbeitet eng mit Praxispartnern zusammen. So beispielsweise im Rahmen des Forschungsprojekts «Schutz in der häuslichen Betreuung alter Menschen» und in den Weiterbildungen in Sozialer Gerontologie und Gerontagogik.
Aufenthaltssicherheit als Ziel
Volksabstimmungen wie die zum Zeitpunkt der letzten Befragung aktuelle Durchsetzungsinitiative verunsichern. Die Befragten fühlen sich nicht anerkannt, ausgegrenzt. Viele haben eine starke Bindung zu ihrer Gemeinde, freuen sich über deren städtebauliche Aufwertung, fühlen sich heimisch – die volle Gleichstellung und Anerkennung und damit auch die Garantie, bleiben zu können, fehlt ihnen jedoch. Politik wird als Sphäre wahrgenommen, die sich vor allem mit der natioethischen Dimension befasst, und gerade hier fühlen sich die jungen Erwachsenen nicht vertreten, abgewertet oder gar systematisch ausgeschlossen. Das Interesse an Politik ist entsprechend gering. Oder mit den Worten von Blerim, 27, «Politik regt mich viel mehr auf, als dass sie mir irgendwie hilft, ganz einfach, und darum beschäftige ich mich nicht so viel mit Politik». Unter diesen Voraussetzungen wird die Aufenthaltssicherheit ein wichtiger Grund für eine Einbürgerung, während die Möglichkeit, abstimmen zu können, nicht im Vordergrund steht.
Unsicherheit schwingt mit
Gefühle der sozialen Verunsicherung lassen sich unter den aktuellen wirtschafts- und sozialpolitischen Bedingungen in weiten Teilen der Gesellschaft beobachten. Die Verunsicherung der Second@s hat insofern eine besondere Qualität, als zusätzlich deren gesellschaftliche Zugehörigkeit bis hin zur Aufenthaltssicherheit infrage gestellt wird. Der Druck auf die jungen Erwachsenen, sich unter erschwerten Bedingungen in der Gesellschaft zu etablieren, ist immens. Marcus Nauer, ehemaliger Leiter Bereich Gesellschaft, Gemeinde Emmen, betont, wie wichtig es wäre, in Beratungen mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen genau hinzuhören, welches ihre Themen und Belastungen seien: «Zu selten wird etwa nachgefragt, welche Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht werden oder welche Sorgen und Hoffnungen es in der Familie gibt.»
Umgang mit Druck
Gemäss Eva Mey, Projektleiterin der Studie, dürfe es insbesondere nicht darum gehen, einseitig immer mehr Druck auf Einzelne auszuüben, während wichtige Massnahmen auf kollektiver Ebene wie ein erleichterter Zugang zu politisch-rechtlicher Gleichberechtigung oder ein verbesserter Diskriminierungsschutz ausblieben. Auch bezogen auf die Lehrstellensuche, einer der prägenden Faktoren im Lebensverlauf der jungen Menschen, wäre es wichtig, Druck herauszunehmen. Indem man die Jugendlichen darin bestärkt, ihren eigenen Weg zu gehen und beispielsweise nicht die erstbeste Chance zu ergreifen, auch wenn sie den eigenen Wünschen und Fähigkeiten nicht entspricht.
Interessiert an einer Weiterbildung zum Thema?
Sensibilisierung tut Not
Zwar wurde in der Schweiz 1978 ein Gesetz eingeführt, das den Eltern das Recht abspricht, ihre Kinder zu Erziehungszwecken körperlich zu züchtigen. Ein explizites Verbot gibt es allerdings nicht. Vor dem Hintergrund der vorliegenden Ergebnisse scheinen eine politische Debatte sowie eine Sensibilisierung der Bevölkerung notwendig. Zum Vergleich: In Deutschland ist ein entsprechendes Verbot seit 2000 in Kraft. Die körperliche Züchtigung als Erziehungsmethode ist vor allem bei Eltern aus dem Kosovo, aus Serbien und aus Mazedonien verbreitet. Ein weiterer wichtiger Faktor, der Gewalt in der Erziehung begünstigt, ist die finanzielle Situation der Eltern. Studienleiter Dirk Baier vermutet, dass Armut als Belastungsfaktor zu einer höheren Gewaltbereitschaft führt.
Studie zur Entstehung von politischem Extremismus
Die Studie zur Entstehung von politischem Extremismus unter Jugendlichen in der Schweiz wird geleitet von Dirk Baier, Patrik Manzoni (beide ZHAW Soziale Arbeit) und Sandrine Haymoz (Haute École de Travail Social Fribourg).
Beitrag SRF «10 vor 10» vom 6. Oktober 2017
Weiterführende Informationen
Beurteilung und Beratung
Die elektronische Auswertung des Online-Fragebogens wird in einer Ampelfarbe angezeigt: Rot steht für dringenden Handlungsbedarf, orange bedeutet weitere Abklärungen und grün weist darauf hin, dass zurzeit kein dringender Handlungsbedarf besteht. Ergänzt wird das Ergebnis durch eine detaillierte Beurteilung durch ausgewiesene Fachpersonen. So können Beratende und Betroffene wie Lehrpersonen, Jugendarbeitende und Eltern gemeinsam ein Lagebild definieren und ein angemessenes Vorgehen besprechen und planen. Dadurch, dass die Anfrage des Tools einfach und anonym (mit Bezug auf die gefährdete Jugendliche / den gefährdeten Jugendlichen) ist, ist die Schwellenangst der Betroffenen klein und durch die Beratung werden ihre Anliegen und Sorgen betreffend die Einschätzung der Situation und das weitere Vorgehen aufgefangen. Bei Extremismus geht es sowohl um Selbst- als auch Fremdgefährdung. Das Präventionsziel ist die frühzeitige Erkennung von Radikalisierungen: Also zu einem Zeitpunkt, an dem noch Einwirkungsmöglichkeiten bestehen, bevor die Einstellungen verhärtet und die Gewaltbereitschaft derart ausgebildet sind, dass Aufklärung und Beratung auf Granit stossen.
Fokus auf Haltungen statt Bärte
In einem nächsten Schritt wurde RA-PROF vom SIFG in Zusammenarbeit mit Miryam Eser Davolio von der ZHAW Soziale Arbeit für einen weiteren Verwendungszweck angepasst: Analog zu RA-PROF wurde ein Tool zur frühzeitigen Einschätzung von rechtsextremistischen Radikalisierungstendenzen entwickelt. Beide Tools – sowohl RA-PROF für jihadistische Radikalisierung als auch das Tool für rechtsextremistische Radikalisierung – sind für die Einschätzung von Personen jeden Alters, also nicht nur von Jugendlichen, geeignet. Es handelt sich dabei nicht um ein Diagnoseinstrument, sondern um eine Checkliste. Die Tools bieten Unterstützung, wenn es darum geht, Einschätzungen zu verdichten und festzustellen, ob Beratungsbedarf besteht. Wer die Checkliste ausfüllt, merkt oft, dass sich viele der Fragen nicht beantworten lassen, da nicht genügend Informationen über die Betroffenen vorliegen. Diese Fragen können wichtige Hinweise darauf geben, auf welche weiteren Aspekte, Einstellungen oder Verhaltensweisen geachtet werden könnte, damit das Bild vollständiger wird. Gleichzeitig sind die Fragen so differenziert ausgelegt, dass das Verstärken gängiger Stigmatisierungen und die Reduktion auf Äusserlichkeiten wie Haare und Kleidung vermieden werden und das Augenmerk stattdessen auf Haltungen und Äusserungen (Ideologie, Schwarz-Weiss-Denken) sowie auf dem Verhalten (Internetnutzung, plötzliche Veränderungen der Lebensweise, Gewaltaffinität) liegt.
Anonymität als Vorteil
Ein grosser Vorteil für Fachleute oder Angehörige, die das Tool benutzen, ist die Anonymität: Es müssen keine Angaben zum potenziell Radikalisierten gemacht werden, die Rückschlüsse auf seine Person ermöglichen. Das Tool führt somit nicht zu einer Denunziation oder zu einem automatischen Einschalten der Polizei. Nur wenn RA-PROF rot oder orange anzeigt und die Beratung den Verdacht auf Radikalisierung erhärtet, legt der Beratende der signalisierenden Person nahe, die Polizei einzubeziehen. Die bisherigen Erfahrungen auf Seiten der Beratenden und der Hilfesuchenden zeigen, dass in den meisten Fällen Entwarnung gegeben werden konnte. In den anderen Fällen waren weiterführende Abklärungen und Beratungen zielführend, so dass die Intervention einer weiteren Radikalisierung vorbeugen konnte.
Deradikalisierung erkennen
Neu wurden zudem ein weiteres Instrument entwickelt, das sowohl jihadistische als auch rechtsextremistische Deradikalisierungstendenzen zu erkennen hilft. DeRA-PROF ist in verschiedenen Schweizer Städten in Extremismus-Beratungsstellen im Einsatz.
Barbara Baumeister und Trudi Beck (Hrsg.)
216 Seiten
Hogrefe Verlag
2017
ISBN: 978-3-45685-664-3
CHF 39.00
Barbara Baumeister, Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Trudi Beck, Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe
Rezension zum Buch, erschienen in Dr. med. Mabuse (PDF 95 kB)
Buch bestellen
Weiterbildungsangebote zum Thema Soziale Gerontologie
Strategische Herausforderung
Markt, Umfeld und Trends zu analysieren, die zukünftige Nachfrage einzuschätzen sowie Strategie, Angebot, Fachkonzept und Marketing anzupassen, ist nicht nur für gewinnorientierte Unternehmen überlebensnotwendig, sondern auch für Non-Profit-Organisationen. Sich diesen Herausforderungen zu stellen, ist daher nicht nur ratsam, sondern unerlässlich. Vor diesem Hintergrund beschliesst die Leitung der Wohn- und Werkstätten Hasenberg, die Entscheidungsgrundlagen für die zukünftige Ausrichtung zusammen mit dem Institut für Sozialmanagement der ZHAW zu erarbeiten. Basierend auf einer massgeschneiderten Offerte des ZHAW-Projektteams wird folgendes Vorgehen vereinbart: Zunächst untersucht das Projektteam systematisch relevante Planungsberichte und Statistiken und führt qualitative sowie quantitative Expertenbefragungen durch. Eine Organisationsanalyse ergänzt die gewonnenen Erkenntnisse. Gemeinsam mit der Auftraggeberin folgt eine Beurteilung der Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken. Die daraus entwickelten strategischen Szenarien bewertet die Einrichtung auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen. Gestützt auf diese Expertise werden Empfehlungen für das weitere Vorgehen formuliert.
Umfeldanalyse
Die Planungsberichte der kantonalen Invalidenversicherungsstellen in Zürich, St. Gallen und im Thurgau sprechen eine deutliche Sprache: Aufgrund der demografischen Alterung wird eine steigende Nachfrage nach (teil-)stationären IV-Leistungen prognostiziert. Nicht alle Fachleute teilen diese Einschätzung und selbst wenn sie zutrifft, bedeutet das mitnichten, dass bestehende Institutionen von einer stetig wachsenden Belegung ausgehen können. Zudem ist eine volle Auslastung nicht mit einer ausreichenden Kostendeckung gleichzusetzen: Schliesslich wird der Betreuungsbedarf komplexer bei gleichzeitigem Anspruch auf möglichst individuell zugeschnittene Dienstleistungen. Dies erhöht den Anspruch an die Vielfalt des Angebots und an die Qualifikation des Personals. Die Standardisierung der Prozesse soll jedoch tiefgehalten werden – eine Quasi-Kumulierung von Kostentreibern. Wenn dazu der Spielraum für Tariferhöhungen abnimmt und die Auflagen steigen, das Selbstbestimmungsrecht der Klientel höher zu gewichten ist und ambulante wie stationäre Leistungen möglichst flexibel miteinander zu kombinieren sind, ist ein ausreichender Deckungsbeitrag nicht mit simplen Massnahmen zu erwirtschaften. Das Fach- und Betreuungskonzept ist ebenso zu hinterfragen wie Prozesse und Führungsstruktur. Eine weitere entscheidende Frage ist die kritische Grösse der Organisation: Ein Ausbau der Platzzahl könnte die Rentabilität der Betreuungsplätze erhöhen, falls die Zielauslastung erreicht wird. Dies ist wiederum von schwer zu beeinflussenden Kriterien abhängig wie der geografischen Lage und der Anbindung an den öffentlichen Verkehr. Mit zunehmender Heterogenität der Zielgruppe erhöht sich ferner die Zahl der zu berücksichtigenden Anspruchsgruppen sowie die Bedeutung einzelner Exponenten. Zuweisende Stellen haben nicht nur unterschiedliche gesetzliche Rahmenbedingungen, sondern auch eine andere Organisationslogik. Dies erfordert eine differenzierte Kommunikation und zielgruppenspezifisches Marketing. Werden all diese Faktoren berücksichtigt, so ergeben sich verschiedene mögliche Handlungsoptionen. Die zu treffenden Entscheidungen werden für die Kundin dadurch nicht einfacher, aber der Entscheidungsprozess wird strukturierter und transparenter.
Soziale Arbeit, Betriebswirtschaft und Sozialwissenschaft kombiniert
Um die Veränderungen im Feld und deren Auswirkungen auf die Wohn- und Werkstätten Hasenberg gezielt zu untersuchen, wird im Projektteam fachliches Know-how der Sozialen Arbeit und der Betriebswirtschaftslehre mit sozialwissenschaftlichen Methoden kombiniert. Drei qualitative Experteninterviews erlauben erste Einschätzungen zur vermuteten Bedarfsentwicklung, zu adäquaten Angeboten und deren fachlicher Ausgestaltung sowie zur Reputation der Einrichtung. Eine Online-Umfrage bei Zuweisenden und weiteren ausgesuchten Akteurinnen und Akteuren der Region ergibt über 60 verwertbare Antwortbogen. Der Trend hin zu komplexeren und individuell flexibleren Unterstützungs- und Betreuungssettings unter grösstmöglichem Einbezug der Klientel bestätigt sich. Ein Handlungsbedarf bezüglich der quantitativen wie qualitativen Ausgestaltung des Angebots sowie hinsichtlich Vernetzung und Marketing zeichnet sich ab.
Organisationsanalyse schlägt neue Wege vor
Ergänzend wird die Einrichtung selbst in den Blick genommen. Strategische und operative Dokumente erläutern das Managementsystem und geben Einblick in Strategie, Kultur und Struktur. Ein Besuch vor Ort bietet die Gelegenheit, mit Personal und Klientel zu sprechen. Die so durchgeführte Organisationsanalyse zeigt bestehendes Potenzial auf sowie Entwicklungsmöglichkeiten hinsichtlich einer Ausweitung oder Veränderung der Zielgruppe.
Mittels der Befunde aus Umfeld- und Organisationsanalyse werden strategische Optionen entwickelt und Szenarien formuliert. Diese werden anhand einer Nutzwertanalyse nach verschiedenen Kriterien bewertet und in einem Workshop miteinander verglichen. Der vertrauliche, knapp 80 Seiten starke Schlussbericht enthält neben einer vollständigen Dokumentation der Untersuchung die Empfehlungen aus der Beraterperspektive. Angewandte Forschung verknüpft sich auf diese Weise mit einer massgeschneiderten Organisationsberatung und schafft so die Grundlage für eine nachhaltige Organisationsentwicklung.
Wissen und Prozessgestaltung aus einer Hand
In dem Prozess zur Überprüfung und Weiterentwicklung einer Unternehmensstrategie bietet es sich an, betriebswirtschaftliche und sozialwissenschaftliche Methoden zu kombinieren. Das Institut für Sozialmanagement unterstützt Non-Profit-Organisationen mit Bedarfserhebungen und Prognosen, mit Markt-, Umfeld- und Trendanalysen, mit Kommunikations- und Marketingkonzepten, mit der Überprüfung von Geschäftsmodell und Businessplan, mit der Ausarbeitung finanzieller Szenarien und mit prozessorientierter Moderation von Angebots- und Strategieentwicklung.
Sozialwerk der Heilsarmee
Die Wohn- und Werkstätten Hasenberg der Heilsarmee in der Gemeinde Waldkirch SG bietet Menschen in besonderen Lebenssituationen vorübergehend oder dauerhaft eine Wohnung und Tagesstruktur respektive Arbeit in einem geschützten Rahmen.
Das Sozialwerk der Heilsarmee führt in der ganzen Schweiz soziale Institutionen. Die Angebote richten sich an den körperlichen, psychischen und sozialen Möglichkeiten von Menschen in Not aus und können sowohl ambulant als auch stationär – vermehrt auch mobil – ausgestaltet sein.
Von der Jugend bis zum Alter
Die im Frühlingssemester durchgeführten Projekte widmeten sich einer grossen Bandbreite an Themen aus verschiedenen Handlungsfeldern: So wurde beispielsweise eine Analyse durchgeführt, wie Unterstützungsangebote für vulnerable ältere Menschen entwickelt werden, sowie ein Befragungstool für Jugendliche erarbeitet, welches in der Jugendarbeit eingesetzt wird. In zwei weiteren Projekten wurden Indikatoren der Inanspruchnahme von Beratungsangeboten von Sozialarbeitenden an einer psychiatrischen Einrichtung erhoben und Good Practice Angebote für Begegnungen zwischen unbegleiteten minderjährigen Asylsuchenden und Schweizer Jugendlichen in vier Kantonen ermittelt.
Probleme lösen – für die Praxis und mit der Praxis
Das TEP-Modul ist über ein Semester angelegt und umfasst einen strukturierten Projektbearbeitungsprozess in Zusammenarbeit mit einer Praxisorganisation oder einer Hochschule mit Bezug zur Sozialen Arbeit im In- und Ausland. Standardmässig bearbeiten zwei Studierende zusammen ein TEP-Projekt. Im Zentrum stehen die Akquise, Planung, Durchführung, Präsentation und Evaluation des Projekts.
Weiterführende Informationen
Zwischen Hilfe und Kontrolle
Der fiktive Fall von Alina illustriert, wie es zu einer Fremdplatzierung kommen kann. Trotz Dringlichkeit wird nicht leichtfertig und möglichst zusammen mit den Betroffenen entschieden. Manchmal aber ist eine durch die KESB angeordnete Platzierung unumgänglich. Neben der Entscheidung für eine Platzierung ist auch deren Umsetzung eine hoch anspruchsvolle Aufgabe: Die involvierten Fachpersonen sind dabei stets mit dem Dilemma von Hilfe und Kontrolle konfrontiert.
Patrizia Gmürs Zustand stabilisiert sich in den darauffolgenden Wochen nur langsam. Doch sie kann Alina regelmässig in der Heimgruppe besuchen. Auch finden dort Beratungsgespräche statt, die sie dabei unterstützen sollen, ihre Mutterrolle neu zu finden und weiterhin auszufüllen. Der Beistand und die Fachpersonen im Heim helfen Alina in vielerlei Hinsicht: So lernt sie ihre Bedürfnisse einzubringen und nach und nach besser zu verstehen, warum ihre Mutter manchmal so abwesend ist. Darüber hinaus findet sie gut Anschluss zu ihren Peers in der Schule und kann das Schuljahr relativ erfolgreich abschliessen.
Für die Fachpersonen, die die Situation im Heim und zuhause regelmässig prüfen, stellt sich die spannungsreiche Frage, ob für Alina eine baldige Rückkehr zur Mutter möglich ist oder inwiefern eine längerfristige Platzierung die bessere Lösung zur Sicherstellung des Kindeswohls wäre. Denn Alina vermisst das Leben bei ihrer Mutter, die den stationären Aufenthalt inzwischen zwar beenden konnte, sich aber (noch) nicht genügend belastbar fühlt, um für Alina zu sorgen. Gleichzeitig gefällt es Alina im Heim sehr gut, wo sie sich auch sichtlich entfalten kann. Insofern bedarf es einer intensiven Zusammenarbeit zwischen Heim, Beistand und Mutter, damit die Beziehung zur Tochter positiv aufrechterhalten wird und so eine Rückkehr möglich bleibt.
Bedarf an Fachwissen und Orientierung
Über die im Platzierungsbeispiel angedeuteten Anforderungen hinaus hat das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht (KESR) seit 2013 allgemein zu einer grossen Nachfrage nach Fachwissen und Orientierung geführt. Es ergaben sich neue Rollen- und Anpassungsanforderungen für die involvierten Dienste und Fachpersonen: Die Fachpraxis ist im Einzelfall tagtäglich mit komplexen Fragen und Herausforderungen konfrontiert. Der Bedarf an fachlicher Orientierung zur Qualitäts- und Haltungsentwicklung, die wissenschaftliche Erkenntnisse mit Erfahrungen der Praxis verknüpft, ist daher im Feld der Fremdplatzierung erheblich. Ein Indiz hierfür ist die anhaltende Nachfrage nach dem «Leitfaden Fremdplatzierung» (Integras 2013). Diese Publikation legt ihr Augenmerk auf die unterschiedlichen Anforderungen und Dimensionen vor, während und nach der Platzierung. Vor diesem Hintergrund und auf Anregungen von Fachpersonen hin entstand das von der Gebert Rüf Stiftung geförderte Projekt «WiF – Wissenslandschaft Fremdplatzierung»: ein Kooperationsprojekt zwischen Integras, Fachverband für Sozial- und Sonderpädagogik, und der ZHAW Soziale Arbeit, Institut für Kindheit, Jugend und Familie.
WiF – Wissenslandschaft Fremdplatzierung
Im Rahmen von WiF wurde das Wissen aus dem Feld der Fremdplatzierung in einem dialogischen Vorgehen zwischen Praxis und Wissenschaft (vgl. Eberitzsch/Gabriel/Keller 2017) aufgearbeitet und über eine Online-Plattform zugänglich gemacht. Konkret bedeutet das: Auf der Basis des aktuellen Forschungsstands und ausgewählter Wissensbestände der Praxis wie Handlungsanweisungen oder Prozessbeschreibungen arbeitete das Projektteam den Platzierungs- und Betreuungsprozess sowie Querschnittsthemen wie Diagnostik/Abklärung, Partizipation oder Kooperation idealtypisch aus. In Workshops mit Fachpersonen aus Institutionen wie Sozialdiensten, von Platzierungsangeboten sowie der KESB oder Jugendanwaltschaft wurden diese Vorarbeiten kritisch diskutiert, bewertet und weiter angepasst. So brachte WiF eine ausdifferenzierte Darstellung der zentralen Prozessschritte hervor, die bei der Umsetzung und Begleitung einer Fremdplatzierung wichtig sind. Daneben wurden in Workshops qualitative Themen bearbeitet: Im Fall von Familie Gmür klingt das Querschnittsthema «Beteiligung der Betroffenen» an, wenn es darum geht, die Mutter in ihrer Rolle zu unterstützen oder gemeinsam mit Alina ein Verständnis für die Gesamtsituation zu etablieren. Die Herausforderungen im genannten Fallbeispiel machen deutlich: Es ist in Fremdplatzierungsprozessen zentral, dass die Fachpersonen gemeinsam über die Möglichkeiten zur Beteiligung des Kindes und seines Familiensystems nachdenken – im besten Interesse des Wohls des betroffenen Kindes.
WiF legt zudem Wert auf einen kantonsübergreifenden Ansatz und auf die Passung zu unterschiedlichen Platzierungspraxen. Zugleich können Themen, die für gelingende Platzierungsverläufe bedeutsam sind, aufgrund der Unterschiedlichkeit der Fälle und Strukturen in der Schweiz nicht einfach als «Best Practice» dargestellt werden. So müssen Unterschiedlichkeiten zugänglich, ersichtlich und diskutierbar sein. Hierzu dienen nicht starre Wahrheiten, sondern systematisch formulierte Reflexionsfragen, die Fachpersonen zur Reflexion ihres professionellen Handelns anregen sollen. Eine Ambivalenz im Fall von Alina ist beispielsweise die Frage nach einer längerfristigen Ausrichtung der Platzierung: Wo ist das Kindeswohl angemessen gewährleistet? Ist die möglichst schnelle Rückkehr zur Mutter zu forcieren oder soll Alina längerfristig im Heim bleiben, einem Umfeld, das offenbar eine positive Wirkung auf das Mädchen hat? Neben Prozessdarstellungen, der Vertiefung zentraler Themen und entsprechenden Reflexionsfragen finden sich auf www.wif.swiss zudem Materialien aus Forschung, Wissenschaft und Praxis. Die Plattform entwickelt sich so langfristig zu einem Kompendium der Themen, fachlichen Konzepte und empirischen Ergebnisse, die bei der Umsetzung einer Fremdplatzierung entscheidend sind.
Laufender Dialog zwischen Forschung und Praxis
WiF basiert auf der Idee, fachliche Inhalte für einen langfristigen und lebendigen Qualitätsdialog zwischen Praxis und Wissenschaft auf einer Online-Plattform bereitzustellen. Fachpersonen, die sich mit Fremdplatzierungen beschäftigen, können sich auf www.wif.swiss direkt mit konkreten Kommentaren und Vorschlägen an der Fortführung der Inhalte beteiligen. Weiter soll auch die Vertiefung von fachlichen Fragestellungen in Workshops und an Tagungen fortgeführt werden zur stetigen Weiterentwicklung der Plattform. Sie bietet so umfassendes und aktuelles Fachwissen an, damit in Fällen wie dem von Alina die beste Lösung gefunden wird: für das Mädchen selbst und für seine Mutter.
Projektteam
, ZHAW Soziale Arbeit, Institut für Kindheit, Jugend und Familie Samuel Keller, ZHAW Soziale Arbeit, Institut für Kindheit, Jugend und Familie Sasha Staiger Marx, ZHAW Soziale Arbeit, Institut für Kindheit, Jugend und Familie Gabriele E. Rauser, Integras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik Laura Valero, Integras Fachverband Sozial- und Sonderpädagogik
Nadia Boscardin ist eine Macherin. Die Mutter von vier Kindern hat nie den einfachen Weg gesucht. Das zeichnete sich schon im Studium an der Soz ab. Statt den Praktikumsteil ihres Studiums wie damals üblich in einer einzigen Organisation zu absolvieren, entschied sie sich für gleich drei anspruchsvolle Aufgaben. Für das erste Praktikum wählte Nadia Boscardin eine Schule für Körper- und Mehrfachbehinderte. Ihre erste Reaktion, als sie als Studentin ein Kind mit Mikrozephalie sah, war: «Kann ich das?» Es sollte sich herausstellen, dass Nadia Boscardin konnte – und wie. Das zweite Praktikum verbrachte sie in einer Stiftung für Kinder und Jugendliche mit geistiger Behinderung oder Lernbehinderung, das dritte in einem Schülerhort. Inzwischen ist es an der ZHAW Standard, den Praxisteil des Studiums aufzuteilen: Die meisten Studierenden absolvieren heute zwei Praktika, damit sie einen besseren Überblick über die Handlungsfelder erhalten. Nadia Boscardin war mit ihrem Vorgehen also gewissermassen eine Pionierin. Am Studium hatte sie stets begeistert, verschiedene Ansätze miteinander zu kombinieren, um die eigene Haltung herauszuarbeiten. «Die ZHAW wie deren Vorgängerinstitutionen haben individuelles Denken gefördert und Mut gemacht, den gewählten Weg dann auch zu gehen – selbst wenn es ein schwieriger war», reflektiert sie heute.
Wissbegierde als treibender Faktor
2013 wurde Nadia Boscardin Bereichsleiterin im Rotacker, Heim und Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, seit 2015 ist sie Geschäftsführerin. Als Grund für ihre beruflichen Entscheidungen gibt sie ihre Wissbegierde an. «Ich suche nicht die Komfortzone, einen bequemen Arbeitsort», ergänzt sie. Das habe zur Folge, dass sie beruflich teilweise sehr exponiert sei. Wie schon im Studium schlägt Nadia Boscardin auch im Beruf gerne neue Wege ein. Wenn sich nicht alles aus der Schublade ziehen lässt und sie Grenzen erweitern kann, blüht sie auf. Bereits auf der Führungsebene sozialer Organisationen angekommen, entschied sie sich 2014, den Master of Advanced Studies (MAS) in Sozialmanagement zu absolvieren, um «den praktischen Erfahrungen ein solides theoretisches Fundament zu geben». Ihr MAS-Studium schloss Nadia Boscardin im Frühling 2015 mit einer Diplomarbeit mit dem Titel «Vom konzeptlosen Aktionismus zur bewussten Kompetenz: eine 80-jährige Geschichte» ab.
Entwicklung als Pflicht und Chance
Als Geschäftsführerin gehören die Weiterentwicklung der Organisation, die Steuerung der Finanzen sowie die Kontrolle von Qualität und Erfolg zu ihren Hauptaufgaben. Das bedeutet, täglich Prioritäten zu setzen und Konsequenzen zu erkennen in einem Kontext mit vielen Variablen. Bestes Beispiel hierfür ist der ganzheitliche Change-Prozess, den es in der Organisation umzusetzen galt. Die Genossenschaft Rotacker wurde vor 84 Jahren von einer Privatperson gegründet. Damals lautete der Auftrag, Arbeit für beeinträchtigte Menschen zu schaffen. Mit den neuen Auflagen und dem neuen Auftrag der Genossenschaft, nicht nur einen Wohn- und Arbeitsplatz zu schaffen, sondern auch Entwicklung und Förderung zu bieten, stiegen die Anforderungen. Es war an Nadia Boscardin, den Neuaufbau der Organisation zu gestalten und die Professionalisierung voranzutreiben: Es galt, einen Entwicklungs- und Förderplan zu entwerfen sowie die Instrumente und Vorgehensweisen dafür zu definieren. In diesen Prozess floss viel Wissen aus dem Certificate of Advanced Studies in Organisationsentwicklung mit ein. Den Change-Prozess erlebte Nadia Boscardin am Anfang wie einen Turmbau – nur dass dabei an sehr vielen Seiten und Stockwerken gleichzeitig gearbeitet werden musste. Bis heute sind die vielen unterschiedlichen Anforderungen die grösste Herausforderung in ihrem Beruf. In diesem Spannungsfeld eine gangbare Lösung zu finden, ist nicht immer leicht. Es ist an ihr, Aufgaben zu gewichten, Anforderungen, die nicht oder nicht gleich erfüllt werden können, zu kommunizieren und dabei den betroffenen Anspruchsgruppen Sicherheit zu vermitteln – und nicht zuletzt, mit Missmut adäquat umzugehen.
Fachlichkeit und Nachvollziehbarkeit als Maxime
Ein Satz der damaligen Dozentin Prof. Dr. Kitty Cassée aus dem Grundstudium begleitet Nadia Boscardin bis heute. Mit jeder neuen Herausforderung bekommt er eine weitere Facette an Bedeutung: «Sozial Tätige wissen, was sie tun, und sind sich ihres Tuns bewusst.» So hat Nadia Boscardin denn auch den Anspruch, dass ihr Handeln stets auf Fachlichkeit beruht und nachvollziehbar ist. Der wirtschaftliche Aspekt steht auch in Non-Profit-Organisationen im Vordergrund. Das Menschliche soll dabei aber nicht zu kurz kommen. Dieser Herausforderung stellt sich Nadia Boscardin jeden Tag aufs Neue und wählt dabei wie schon als Studentin nicht den einfachsten Weg.
Leben und Arbeiten beidseits der Norm
Der Rotacker ist eine gemeinnützige Organisation, basierend auf der Rechtsform der Genossenschaft. Er bietet Personen mit psychischen, physischen und geistigen Beeinträchtigungen ungeachtet ihrer Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer Konfession geschützte Arbeitsplätze und Wohnmöglichkeiten an. Dafür stehen insgesamt 37 Arbeitsplätze zur Verfügung, davon 20 in Wallisellen und 17 in Fehraltorf. Das Wohnheim in Wallisellen umfasst 14 Wohnplätze.
Master of Advanced Studies (MAS) in Sozialmanagement
Fundierte Managementkenntnisse gehören heute zum Anforderungsprofil von Führungskräften aus Organisationen mit sozialem Auftrag. Nur so können sie ihr Unternehmen erfolgreich positionieren, ihre Mitarbeitenden optimal führen und die Zusammenarbeit gezielt fördern. Der MAS vermittelt aktuelles Wissen rund um Führungsfragen, Personalmanagement, Betriebswirtschaft, Marketing und Organisationsentwicklung.
von Urs Frey
Die schweizerische Wohnbevölkerung wächst. Die Landschaft verstädtert zusehends und die Städte selbst üben eine wachsende Magnetwirkung aus. Allein für Zürich wird bis 2040 ein Zuwachs um 80’000 Menschen prognostiziert, was etwa der Stadt St. Gallen entspricht. Im Zürcher Boomkreis 9 beherbergt die neue Grosssiedlungen Freilager weit über 2’000 Menschen. Kein Zweifel also, die Menschen rücken einander näher, und mit den neuen Überbauungen entstehen neue lokale Nachbarschaften. Eine spannende Herausforderung für die Soziale Arbeit also, die sich seit ihren Anfängen im elenden Londoner East End des ausgehenden 19. Jahrhunderts für das Zusammenleben im Nahraum interessiert.
Von Vera Bäriswyl
Wer das südostasiatische Malaysia noch nicht bereist hat, sollte dies eines Tages unbedingt tun. Malaysia bietet alles, was man zum Wohlfühlen braucht: eine vielfältige Natur, gastfreundliche und interessierte Menschen, eine bunte Küche und ewigen Sommer. Die einladende Atmosphäre lässt einen sich schnell heimisch fühlen. Dass die Menschen sehr zufrieden sind und die Kriminalitätsrate im Allgemeinen sehr tief ist, verdankt das Land unter anderem einer Besonderheit, von der so manches Land noch weit entfernt ist: dem friedvollen Zusammenleben verschiedener Religionen und Ethnien. Obwohl der Islam die Staatsreligion ist, gehören nur etwa 60% der Bevölkerung dieser Glaubensrichtung an. Gefolgt wird sie von Buddhismus mit rund 20%, Christentum mit rund 10%, Hinduismus mit rund 6% und weiteren Religionen. Die Religionsfreiheit ermöglicht allen Glaubensgemeinschaften, ihre Feste und Bräuche in und mit der Öffentlichkeit zu teilen. So stehen Moschee, Tempel und Kirche oftmals direkt nebeneinander, ohne dass sich jemand daran stört. Der Staat übt allerdings eine gewisse Diskriminierung gegenüber nichtmuslimischen Menschen aus. So werden muslimische Schulen, Organisationen und Moscheen staatlich unterstützt. Rechtlich gesehen müssen alle Malaien muslimisch sein, was sogar im Pass ausgewiesen ist. Sie verlieren beim Konvertieren den Status als ursprüngliche Malaien mit sämtlichen Privilegien. Trotz oder gerade wegen dieser Tatsache unterstützt die Regierung des Staats Penang die Kulturverständigung tatkräftig. So ist bei den zahlreichen kulturellen Veranstaltungen über das ganze Jahr eine ethnische Durchmischung der Besuchenden erwünscht und wird teilweise auch von den Religionsgemeinschaften weitergetragen. Ein schönes Beispiel dafür ist der Auftritt einer indisch-malaysischen Tanzgruppe am chinesischen Neujahrsfest.
Szenen statt lokaler Nachbarschaften?
Nur, ist dieser historische Ort mit dem aufstrebenden Zürich von 2017 zu vergleichen, wo ein mittelständisches Lebensgefühl die Atmosphäre prägt? Was hat hier gemeinwesen- bzw. sozialraumorientierte Soziale Arbeit verloren? Die Frage ist umso mehr berechtigt, als im Zeitalter von Instagram, Skype und EasyJet Beziehungsnetze weit ausgeworfen werden und Wohnen, Arbeiten, Freundeskreise, Freizeitangebote oder Einkaufsmöglichkeiten stark auseinander liegen können. Räumliche Nähe ist weniger denn je eine Voraussetzung für Beziehungspflege. Statt unter Nachbarn finden wir uns immer mehr entlang beruflicher, weltanschaulicher oder anderweitiger Zugehörigkeiten zu Gemeinschaften, sprich Communities zusammen. Dass die eigene Kirche – so sie denn überhaupt besucht wird – noch im Dorf steht, dass der frequentierte Club ein Ortsverein ist und der Lieblingsladen sich um die Ecke befindet, wird immer unwahrscheinlicher. Ein Trendbericht, im Auftrag der Sozialen Dienste der Stadt Zürich erstellt, prognostiziert denn auch, dass solche szenischen Nachbarschaften wichtiger werden.
Staat und NGOs unterstützen Hand in Hand
Die professionelle Soziale Arbeit in Malaysia hat ihre Anfänge in den 1930er Jahren, hervorgerufen durch die britische Kolonialverwaltung, die ihren Fokus auf die Wanderarbeiter aus Indien und China legte. 1946 wurde das erste Departement für Sozialhilfe gegründet, da Themen wie Jugenddelinquenz und Armut in den Vordergrund traten. Neben finanzieller Unterstützung für Bedürftige gehörte die Heimpflege für ältere Menschen und Menschen mit Behinderung zum Arbeitsfeld der Sozialarbeitenden. Weiter waren sie in Bewährungsprogrammen für straffällige Jugendliche oder in Schutzhäusern für Frauen und Mädchen tätig.
Heute leisten neben den staatlichen Organisationen unzählige NGOs essentielle Arbeit und ergänzen durch ihre spezifischen Themenfelder wie Kindsschutz oder Frauenrechte das staatliche Welfare Department. Die Angebote der NGOs richten sich einerseits gezielt an bestimmte ethnische Gruppen, was bei Kinderheimen sehr deutlich wird. So existieren buddhistische Heime für Kinder von chinesischen Malaien oder hinduistische Heime für indisch-malaysische Kinder. Im Gegensatz dazu spiegelt sich die Toleranz für Diversität der malaysischen Bevölkerung in anderen Bereichen wider, wie in der Altenpflege, wo die Klientel sowie die Angestellten von verschiedenster Herkunft sind. Interessant ist die Tatsache, dass es keine Anlaufstellen, Therapien oder Prävention im Suchtbereich gibt. Wie in muslimischen Ländern üblich ist der Konsum von Suchtmitteln verpönt oder sogar verboten. Auf Besitz und Handel mit illegalen Substanzen drohen Stockhiebe, hohe Bussen oder gar die Todesstrafe. Suchterkrankte werden zu Hause von der Familie betreut und sind in der Öffentlichkeit nicht sichtbar. Ein weiterer grosser Unterschied zur Sozialen Arbeit, wie wir sie kennen, ist der Umgang mit Langzeitarbeitslosigkeit. Das staatliche Welfare Department unterstützt nur bedürftige Personen wie Alleinerziehende, Menschen mit Behinderung und ältere Menschen. Wer jung und arbeitsfähig ist, kann keine Gelder beantragen.
Grundsätzlich bietet das Welfare Department Unterstützung mit wenig Betreuungscharakter und die NGOs sind für Dienstleistungen über die Finanzierung hinaus zuständig. Dies liegt unter anderem daran, dass die Angestellten in den NGOs besser geschult werden und diejenigen des Welfare Department befördert werden, sobald sie auf einer professionellen Stufe angekommen sind. Die Zusammenarbeit ist unabdingbar, da die NGOs über das professionelle Wissen verfügen, das Welfare Department aber die gesetzlichen Kompetenzen hat, beispielsweise im Kindsschutz.
Rückzug ist keine Antwort
Areal-Entwickler – zumindest im Luxussegment – tragen das Ihre dazu bei, dass lokale Nachbarschaft gar nicht erst entsteht. Der Concierge beim Empfang oder der direkte Lift von der Parkgarage bis zur Wohnung sorgen dafür, dass man sich nicht unliebsam in die Quere kommt. Für diese Vermeidungsstrategie spricht vieles. Bernd Hamm weist in seinem Standardwerk «Betrifft: Nachbarschaft» darauf hin, dass die oft ideologisch-idealisierende Sicht auf Nachbarschaft von der Tatsache ablenkt, dass es sich hierbei historisch um eine Schicksalsgemeinschaft mit vielfältigen ökonomischen, sozialen und politischen Abhängigkeiten und Zwängen handelte, aus denen es in der Regel kein Entrinnen gab. Und wer wollte bestreiten, dass es Animositäten, Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten unter Nachbarn auch heute noch gibt?
WCC – eine NGO mit feministischem Ansatz
Die Offenheit und Toleranz in Malaysia zeigt sich auch in Sachen Frauenrechte. Die islamischen Malaiinnen unterscheiden sich kaum von Frauen anderer Religionen. Ihnen sind keine einschränkenden Gesetze auferlegt und sie haben Zugang zu Bildung, freie Berufswahl und müssen sich nicht verschleiern. Dennoch ist häusliche Gewalt leider ein verbreitetes Problem.
Die Frauen im Staat Penang und aus der nördlichen Region hatten lange keine Anlaufstelle: 1985 dann gründeten fünf Frauen das Women’s Centre for Change (WCC), unter ihnen Rechtsanwältinnen, Lehrerinnen und Heimleiterinnen. Heute besteht das WCC-Team aus insgesamt 15 Festangestellten aus Sozialer Arbeit, Psychologie und Rechtswissenschaft sowie 40 bis 60 Freiwilligen aus weiteren Berufsfeldern. Mission ist die Bekämpfung der Gewalt gegen Frauen und Kinder, das Empowerment von Frauen und Kindern, die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter sowie die soziale Gerechtigkeit. Das WCC umfasst zwei Abteilungen. Die grössere setzt sich aus Sozialarbeitenden zusammen, die mehrheitlich für die Beratung der Opfer häuslicher Gewalt und sexueller Belästigung zuständig sind. Die kleinere juristische Abteilung hat die anwaltschaftliche Betreuung und Beratung der Klientel zum Auftrag, klärt sie über ihre Rechte auf und begleitet sie emotional und organisatorisch bei allfälligen Gerichtsverfahren. Beide Abteilungen veranstalten regelmässig Schulungen und Workshops, halten Vorträge und beteiligen sich an aufsuchender Aufklärungsarbeit. Essentiell ist hierbei die interdisziplinäre Kooperation wie etwa mit Krankenhäusern, Polizei, Schulen, Universitäten und Jurisprudenz.
Eine Problematik, mit der sich das WCC immer wieder konfrontiert sieht, ist die Verhaltensweise der Polizei. Wendet sich eine Frau aufgrund von häuslicher Gewalt an die Polizei, wird sie häufig nicht ernst genommen und sogar abgewiesen. Die meisten Betroffenen unternehmen deshalb keine weiteren Schritte und kehren zum Täter zurück. Die Folgen können verheerend sein, da ein Polizeirapport für ein gerichtliches Verfahren Voraussetzung ist, eine Anzeige jedoch durch das Fehlverhalten der Polizei verhindert wird. Die Sensibilisierungsarbeit mit der Polizei beschäftigt sich in erster Linie mit der Aufklärung darüber, was häusliche Gewalt ist, und mit deren Auswirkungen auf die Betroffenen. Es wird sorgfältig aufgezeigt, wie der richtige Ablauf bei einer Meldung wäre und wie wichtig die Polizei als erste Anlaufstelle ist.
Die Haltung der Polizei zeigt, dass in der Gesellschaft oftmals Unwissen darüber besteht, was häusliche Gewalt ist und dass sie überhaupt existiert. Das WCC versucht, so viele Menschen wie möglich auf die Problematik von Diskriminierung, häuslicher Gewalt und sexueller Belästigung aufmerksam zu machen. Dafür werden diverse Plattformen genutzt, wie das George Town Festival: ein alljährlicher öffentlicher Event, der einen Monat dauert und Hunderte von Programmpunkten im Bereich Kunst beinhaltet. Das WCC organisierte 2015 in diesem Rahmen die Ausstellung «My story, my strength: doodle for change». Malaysische Künstlerinnen setzten die Geschichten von Frauen, die häusliche Gewalt oder sexuellen Missbrauch erlebt hatten, in ihren Bildern und Kunstwerken um. Die Ausstellung, von einer prominenten Künstlerin und Politikerin moderiert, wurde zum Erfolg und von diversen Zeitungen gelobt.
Das enorme Engagement der Sozialarbeitenden sowie der Zusammenhalt verschiedener NGOs über die einzelnen Staaten in Malaysia hinaus sind entscheidend für die Weiterentwicklung der Sozialen Arbeit im Land und für das Bewusstsein, dass es NGOs wie das WCC braucht. Es bleibt zu hoffen, dass die Vision des WCC irgendwann Realität wird: Eine Gesellschaft, die frei ist von geschlechtsspezifischer Gewalt und Diskriminierung und in der Frauen ihr volles Potenzial verwirklichen können.
Renaissance des Nahraums
Doch Abschottung und Rückzug in die szenische Nachbarschaft funktionieren nur bedingt und sind auch nicht wirklich erstrebenswert. Selbst wer den legendären helvetischen Kleinkrieg um die Waschküche nicht mehr ausfechten muss, weil der eigene Waschturm in der Wohnung steht, hat doch nicht alle Berührungspunkte mit den Nachbarn aus der Welt geschafft. Können wir die kontaktfreudigen Kinder in den eigenen vier Wänden festhalten? Wo leihen wir uns den zusätzlichen Stuhl, wenn die Zahl der Gäste das Erwartete übersteigt? Vielleicht wüsste man sich schon zu helfen, auch ohne Hilfe von nebenan. Doch gute Nachbarschaft ist praktisch und bequem.
Selbst im erweiterten Umfeld, im Dorf oder im Quartier ist der Mensch auf physische Nähe angewiesen. Die Identifikation mit dem Wohnort ist den meisten wichtig. Wie sonst kommt es, dass der Verlust der eigenen Wohnung zu den schmerzhaftesten menschlichen Erfahrungen gehört. Fernbeziehungen und das Knüpfen globaler Netze mögen reizvoll sein, doch sie sind auch kompliziert. Weshalb also nicht ein paar Freundschaften auch im Nahraum kultivieren? Kommt hinzu, dass wir allmählich an die physischen und ökologischen Grenzen der Mobilität gelangen und das Agieren in kleineren Radien den Lebensstil der Zukunft bestimmen wird.
Autorin
Vera Bäriswyl hat nach ihrem Masterstudium in Sozialer Arbeit an der ZHAW während eineinhalb Jahren in Malaysia gelebt und gearbeitet, unter anderem im Rahmen eines Praktikums beim WCC. Heute ist sie in der Sozialberatung der Stadt Dietikon tätig.
Zwischen Laissez-faire und Sozialraum-Strategie
Auch der Stadtforscher Walter Siebel betont die Bedeutung der modernen lokalen Nachbarschaft, wenn er festhält, dass diese früher eine räumliche Tatsache war, die sich sozial organisiert, während sie heute eine soziale Tatsache ist, die sich räumlich organisiert. Damit unterstreicht er nicht nur die Wählbarkeit der eigenen Nachbarschaft, sondern weckt auch die Vorstellung von Menschen, die bereit und fähig sind, ihr Zusammenleben gemeinsam zu gestalten. An diesem sympathischen Menschenbild ist aus Sicht der Sozialen Arbeit grundsätzlich nichts auszusetzen. Auch Immobilienfirmen überlassen es gerne der bunt zusammengewürfelten Mieterschaft in den neuen Grosssiedlungen, das soziale Zusammenleben in einer Art Laisser-faire-Strategie selber zu entwickeln. Dabei geht es ihnen allerdings vor allem um Kostenersparnis und Verantwortungsdelegation.
Diese Strategie funktioniert erfahrungsgemäss zwar leidlich gut. Dennoch müsste es hellhörig machen, dass gerade neue und traditionelle Wohngenossenschaften, die sich im Umbruch befinden, vermehrt dazu übergehen, sich punktuelle Unterstützung aus dem animatorischen, gemeinwesenarbeiterischen Feld zu holen oder eigens dazu Fachmitarbeitende anzustellen. Denn wo sind das Wissen und das Bewusstsein um den Nutzen und den Mehrwert einer gut gepflegten Nachbarschaft grösser als in diesen in Mitwirkung und Selbstorganisation geübten Organisationen? Solche neue oder erneuerte Siedlungen unter Mitwirkung professioneller Impulsgeberinnen und Begleiter haben das Potenzial, sich zu Zukunftslabors einer guten Nachbarschaft und zu Leuchttürmen des gelingenden sozialen Lebens zu entwickeln.
Quartierentwicklung – kein Luxus, sondern oft Notwendigkeit
Siedlungs- und Quartierentwicklung in enger Zusammenarbeit mit Mieterschaft, Vermietern, Planungsbüros, Immobilienfirmen und Behörden ist auch in mittelständischen Gegenden keineswegs ein Luxus. Wobei unter dem Gesichtspunkt der Sozialen Arbeit das aktuelle Bild der prosperierenden Stadt nicht davon ablenken darf, dass sich – oft an deren Rändern – auch die Verliererinnen und Verlierer dieser Entwicklung sammeln. Ärmere, darunter oftmals ältere Menschen, solche mit kinderreicher Familie oder mit Migrationshintergrund sind bei der Wahl ihres Wohnorts stark eingeschränkt, und auch der Pflege szenischer Nachbarschaften sind engere Grenzen gesetzt. In den sich so mehr notgedrungen denn freiwillig bildenden lokalen Nachbarschaften fand die sozialraumorientierte Soziale Arbeit schon immer ihr angestammtes Arbeitsfeld und wird es wohl nicht so schnell wieder verlieren. Kurzum: Die Sozialraum-Strategie zur Pflege der guten Nachbarschaft bleibt aktuell, notwendig und zukunftsfähig.
Weiterführende Informationen
Mit Fehlern produktiv umgehen
Gerade weil sie sich nicht vermeiden lassen, gilt es, einen guten Umgang mit ihnen zu finden. Doch was bedeutet das? Wie können Unternehmen eine Arbeitskultur schaffen, in der Platz für Fehler ist? Was bedeutet das für das Verhalten der Führungskräfte? Und sind Fehler am Ende besser als ihr Ruf und können auch etwas Gutes bringen? Michael Herzig, Dozent am Institut für Sozialmanagement, liefert im White Paper «Fehlerkultur: Was ist ein produktiver Umgang mit Fehlern?» Antworten und Empfehlungen.
Ein Format ohne Entwicklung?
Supervision hat sich als Beratungsformat in sozialen und sozialnahen Aus- und Weiterbildungen sowie in Dienstleistungen für solche Organisationen bewährt. Hat sich das Format daher ‒ vor allem angesichts der starken Konkurrenz durch Coaching und Organisationsentwicklung ‒ in seinem bewährten Terrain eingeigelt und fristet so als Specie rara in kleinen Biotopen unausrottbar sein Dasein? Sicher ist: Das Sein und mögliche Werden oder Absterben des Formats steht zur Diskussion. Wie nutzbringend ist Supervision für Kundinnen und Kunden wirklich und kann sie mit Einzelnen, Teams und Organisationen tatsächlich Antworten finden auf drängende Herausforderungen sowie nötige innovative Entwicklungen unterstützen oder gar initiieren oder dient sie lediglich der Strukturerhaltung und der Psychohygiene? Will man Fragen nach der Zukunft und dem Potenzial von Supervision beantworten, gilt es, den Kontext zu betrachten, in dem sie stattfindet.
Potenziale für die Supervision
Viele Supervisionsformen und -aufträge sind wenig konturiert, was sie diffus und potenziell enttäuschend werden lässt. So vereint beispielsweise «Teamsupervision» eine Vielzahl von oft ungeklärten Veränderungswünschen, impliziten Hoffnungen und individuellen Erwartungen. Zusätzlich wird der institutionellen Rahmung wenig Beachtung geschenkt. Die beteiligten Expertinnen und Experten bringen ihre spezifischen Vorerfahrungen, ihre berufliche Sozialisation, ihre aktuelle Befindlichkeit und ihre professionellen Selbstverständnisse in die Supervision ein. Entsprechend vielfältig und unterschiedlich sind die Erwartungen: Beziehungsförderung, Klärung der Zusammenarbeit, Schutz, Veränderung «von unten», Unterstützung gegen «schwierige» Teamkolleginnen und -kollegen, Hilfe bei Arbeitsbelastung und -bewältigung, konkrete Tipps bei komplexen Fällen, Antworten im Sinne von Best Practices und Standards. Eine Klärung dieser Unterschiedlichkeiten setzt einen eigenen reflexiven (Vor-)Supervisionsprozess vor Beginn der thematischen Supervision voraus. Doch ein sorgfältiger Auftragsklärungsprozess wird meist nur murrend mitgemacht, denn «es ist ja klar, worum es geht».
Komplexe Spannungsfelder aktiv bearbeiten
Supervision hat immer mit (hidden) Agendas der Führungskräfte und Auftraggebenden zu tun, die sich oft von den Interessen der Mitarbeitenden unterscheiden. Diese Divergenz wird zum Teil bei der Auftragserteilung thematisiert und so in den reflexiven Prozess einbezogen, zum Teil nur vage angedeutet und zum Teil gänzlich unterschlagen. Positive Erwartungen werden eher offen formuliert: «Helfen Sie uns, die Organisation zu verbessern», «Stärken Sie die Mitarbeitenden». Beanstandungen können eher indirekt daherkommen: «Es geht auch um die Entwicklung der fachlichen und sozialen Kompetenzen von einzelnen Mitarbeitern, da gibt es doch gewisse Unterschiede.» Supervision kann die eigenen Ausgangsbedingungen und Erfolgsaussichten verbessern, wenn die zugrundeliegenden Motive berücksichtigt und sorgfältig geklärt werden. Die Schnittmenge von Supervision, Führungscoaching und Organisationsberatung birgt für solche Situationen viel Potenzial, jedoch auch das Risiko zusätzlicher Diffusität.
Das grosse Ganze im Blick behalten
Supervision wird oft als isolierte Massnahme behandelt. Sie wird als tradierte, wenig reflektierte und fokussierte Massnahme bestellt und nicht mit anderen in der Institution aktuellen Aktionen verknüpft wie der Einführung neuer Arbeitskonzepte, Führungscoachings, Weiterbildungen oder Qualitätssicherung. Dies führt zu einem Gefühl ritualisierter Beliebigkeit und verschenkt das Potenzial von strategisch ausgerichteten und stringent koordinierten Entwicklungsmassnahmen. Das Ergebnis ist punktuell hilfreiche Unterstützung im Einzelfall, aber fehlende Nachhaltigkeit für die Mitarbeitenden und die Organisation sowie ihre Kundinnen und Kunden. Der Nutzen von Supervision kann deutlich verbessert werden, wenn sie mit andere Themen und Aktivitäten koordiniert wird. Dabei ist die Herausforderung für Supervisorin und Supervisor sowie Organisation, Aufwand und Abgrenzung passend zu gestalten.
Professionalität, Reflexion und Wirkung
Die Definition von Supervisions-Aufträgen stützt sich zu wenig auf professionelle Kriterien. Die Wahl der Supervisorin oder des Supervisors wird oft zu stark von Sympathie, Supervisionserfahrung, Branchenkenntnis und dem Anwenden bewährter Kommunikationsrituale abhängig gemacht. Ein explizites Anforderungsprofil sowohl für die Supervision als auch die Supervisorin oder den Supervisor könnte schon vor Beginn des Beratungsprozesses viel bewirken. Gleichzeitig sind Supervisorinnen und Supervisoren gefordert, in professionellen Situationen mit hoher Komplexität und hohem Druck Reflexionsmöglichkeiten (Zeiten, Gefässe, Kompetenzen) zu finden. Ein wichtiges Thema ist die Wirkung von Supervisionen, die oft zu wenig thematisiert wird. Supervisions-Auswertungen sind nicht selten Happiness-Überprüfungen. Die Frage, welche Wirkung eine Supervision erzielen soll, und die Überprüfung dieser Effekte wird oft vage gehandhabt, ja stösst auf Unwillen. Supervisorinnen und Supervisoren, aber auch die entsprechenden Beratungsformate sollten ihr Nutzenversprechen klarer formulieren und einlösen.
Alt bewährt, aber nicht ausgedient
Bei allen Herausforderungen darf etwas nicht vergessen werden: Supervision funktioniert. Und zwar allein schon aufgrund der Tatsache, dass sie stattfindet und dazu einlädt, die eigene Situation zu präsentieren sowie vertieft und anders darüber zu reflektieren. Doch es trifft auch zu, dass das Format mehr Potenzial hat, als im Moment ausgeschöpft wird. Soll eine Weiterentwicklung gelingen, muss eine gute Balance gefunden werden zwischen bewährten Supervisionsritualen und dem selbstreflexiven Herausfordern und Hinterfragen der Routine. Auftraggebende müssen davon überzeugt werden, dass sich eine umfassende und präzise vorgängige Auftragsklärung lohnt. Diese beinhaltet nicht nur den aktuellen Bedarf, sondern auch konkrete Zielsetzungen und Nebenwirkungen, eine differenzierte Analyse des Kontexts sowie die bewusste und intelligente Vernetzung mit anderen Initiativen in der Institution. Die Herausforderungen für alle Beteiligten sind vielfältig: Es gilt, nutzbringende Formatverschränkungen zu praktizieren. Führungsthemen und -problematiken müssen konstruktiv in Supervisionsprozesse eingebunden werden, Themen der Organisationsentwicklung berücksichtigt werden, ohne sich anderen Formaten anzubiedern und eigene Grenzen zu vergessen oder diffus zu werden. Experimentierfreudigkeit soll zur Verbesserung der Beratungsqualität eingesetzt und die damit verbundenen Risiken sollen bearbeitet werden. Die Ergebnisse der Supervision können nicht für sich allein stehen, sondern müssen in den Q-Zyklus der Organisation eingebunden werden. Weiteres Potenzial besteht in nicht sozialen/pädagogischen Berufswelten und umgekehrt im Nutzen neuer Erkenntnisse aus «fremden» Feldern wie innovative Führungs- und Organisationskonzepte und Kooperationsmodelle. Für die Zukunft ist nicht zuletzt entscheidend, dass die Supervision ihre besondere Reflexionskompetenz selbstbewusster lebt und «verkauft». Dadurch kann die moderne Supervision ein explizites und ganzheitliches Versprechen von Nutzen und Qualitätsbewusstsein in den Mittelpunkt stellen – für Mensch und Organisation.
Tagung «Zukunft der Supervision: Reflexionen, Visionen, Entwürfe»
Am 31. August und 1. September 2017 organisieren die ZHAW Soziale Arbeit und das isi – institut für systemische impulse in der Limmathall in Zürich eine Tagung zu diesem kontroversen Thema. Die Tagung bietet vielfältige Impulse aus verschiedenen fachlichen Perspektiven und eine spannende Plattform für Vernetzung.
Weitere Informationen und Anmeldung
Kumulierung von sozialen Ungleichheiten im Lebenslauf
Herkömmliche Studien zur sozialen Ungleichheit gehen kaum darauf ein, dass sich die Ungleichheit im Lebenslauf kumulieren, also von einer Reichtums- bzw. Armutsdynamik auszugehen ist. Finanziell Bevorzugte werden immer reicher, während Benachteiligte im Vergleich dazu immer weiter «zurückfallen». Auch hier sind die Wirkungsmechanismen vielfältig und können an dieser Stelle nicht im Detail beschrieben werden. Beispiele sind, dass Privilegierte weniger gesundheitliche Probleme haben und dadurch auch weniger mit krankheitsbedingten Einkommensverlusten konfrontiert sind. Oder dass sich finanziell Bessergestellte in jungen Jahren eher ein Eigenheim leisten können und gerade in Zeiten tiefer Hypothekarzinsen von Jahr zu Jahr mehr finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Das Resultat dieser Dynamiken ist, dass die Ungleichheit im Alter deutlich grösser ist als in der Gesamtbevölkerung oder in jüngeren Altersgruppen.
Die Rolle der Altersvorsorge
Die Reduktion der im Lebenslauf verschärften Ungleichheiten war ein wichtiges Ziel beim Aufbau der schweizerischen Altersvorsorge seit dem 2. Weltkrieg. Entsprechend enthält die AHV als 1. Säule der Altersvorsorge zusammen mit dem System der Ergänzungsleistungen am meisten Umverteilungselemente. Einerseits werden die AHV-Beiträge im ursprünglichen Umlageverfahren in Relation zur Lohnhöhe berechnet, die Renten andererseits haben einen eingeschränkten Schwankungsbereich (aktuell zwischen Fr. 14‘100.- und Fr. 28‘200.- pro Jahr für eine Einzelperson).
Die Umverteilungswirkung der AHV blieb über die Jahre grundsätzlich erhalten, wurde lediglich in dem Masse abgeschwächt als Beiträge aus der Mehrwertsteuer dazukamen, welche finanziell schlechter Gestellte stärker belasten als Lohnabzüge. Die 2. und 3. Säule der Altersvorsorge haben dagegen einen ungleichheitserhöhenden Effekt: Personen mit höherem Einkommen können sich mehr Geld ansparen und erhalten dabei auch einen grösseren «Zustupf» seitens der Arbeitgebenden.
Altersreform 2020
Die Altersreform 2020 hat vor dem Hintergrund von demografischen Veränderungen und Finanzierungsproblemen das Ziel, die Altersvorsorge als Gesamtsystem für die Zukunft zu sichern. Im Laufe der nächsten Monate sollte im Parlament an der Differenzbereinigung gearbeitet werden. Eine Volksabstimmung wird gegenwärtig für Herbst 2017 in Aussicht genommen.
Auf der Basis der vorangehenden Überlegungen sollte der konkrete Vorschlag wesentlich danach beurteilt werden, ob er einen Beitrag zur Reduktion der immer grösseren Ungleichheit im Alter leistet. Dabei kann davon ausgegangen werden, dass bei einer relativen Stärkung der 1. Säule (AHV) zulasten der 2. Säule (Pensionskassen) dieses Ziel erreicht wird. Im umgekehrten Fall würde die Ungleichheit im Alter zusätzlich erhöht. Grundsätzlich wäre für eine ungleichheitsreduzierende Altersvorsorge auch zu fordern, dass die Mehrwertsteuerfinanzierung der AHV zurückgefahren und die Lohnprozentfinanzierung erhöht wird. Ein solcher Vorschlag hätte aber wahrscheinlich erst dann eine Realisierungschance, wenn die Vorlage an der Urne scheitern würde.
Armut im Alter
Weniger umstritten als das Bestreben, Ungleichheit zu reduzieren, ist in der Politik und im öffentlichen Diskurs die Ansicht, dass das Gesamtsystem der Altersvorsorge Armut im Alter verhindern sollte. Dabei wurde erst in den 80-er Jahren des letzten Jahrhunderts damit begonnen, Armut in der Schweiz zu untersuchen. 1998 ist eine erste gesamtschweizerische Armutsstudie von Leu, Burri & Priester (1998) erschienen, die den Fokus nicht auf Altersarmut legte, sondern im Gegenteil darauf hinwies, dass die Quote der von Armut Betroffenen ebenso wie die sogenannte Armutslücke (Einkommensdifferenz zur Armutsgrenze) insbesondere dank der schweizerischen Altersvorsorge mit zunehmendem Alter zurückgehen (Daten für 1992).
Eine Studie des Bundesamtes für Statistik im Jahre 2014 („Armut und Alter“) zeichnete dann aber ein anderes Bild. Demnach liegt die Armutsquote der Menschen über 65 Jahren deutlich über jener der jüngeren Altersgruppen und steigt zwischen den 65- bis 75-Jährigen und den Menschen ab 75 von 12,5% auf 22,1% deutlich an (S.8).
Ein wichtiger Aspekt dieses Anstiegs der Altersarmut ist, dass in den letzten Jahrzehnten die 2. Säule in der Altersvorsorge immer mehr an Bedeutung gewonnen hat und trotzdem (bzw. gerade deshalb) hat die Altersarmut offensichtlich zugenommen.
In der aktuellen Diskussion über die zunehmende Altersarmut braucht es allerdings eine kritische Reflexion der verwendeten Indikatoren. So wird teilweise in verkürzender Weise auf den zunehmenden Anteil der Ergänzungsleistungsbeziehenden als Armutsindikator verwiesen.
Intersektionale Perspektive
Der öffentliche Diskurs zur Zukunft der Altersvorsorge ist geprägt von Argumenten, die sich auf die Situation von «Durchschnittsrentnern» (in der Regel Männer) beziehen. Die Soziale Arbeit ist gefordert, hier eine intersektionale Perspektive einzubringen, eine Perspektive also, die systematisch verschiedene Differenzkategorien in ihrem Zusammenspiel berücksichtigt und darauf basierend gezielte Verbesserungsvorschläge entwickeln kann (vgl. beispielsweise Winkler & Degele 2010). Die bisher vorgebrachten Überlegungen haben sich auf Differenzen und Ungleichheiten in der wirtschaftlichen Lage von Menschen im Alter konzentriert. Eine umfassendere intersektionale Analyse hätte auf jeden Fall auch die Differenzkategorien Geschlecht und Migrationsstatus zu berücksichtigen.
Die oben erwähnten Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen, dass Frauen mit 20% deutlich stärker von Altersarmut betroffen sind als Männer mit 12%. Dies hat wesentlich mit mehr Teilzeitarbeit und einer eingeschränkten Absicherung durch die 2. Säule zu tun. Auch der Blick auf die Frauen, für die in der Altersreform 2020 ein um 1 Jahr höheres Rentenalter vorgesehen ist, spricht eindeutig dafür, die 1. Säule der Altersvorsorge zulasten der 2. Säule zu stärken.
Schliesslich ist zu berücksichtigen, dass auch Ausländerinnen und Ausländer mit 23% häufiger von Altersarmut betroffen sind als Schweizerinnen und Schweizer mit 16%. Auch hier könnte man mit einem Ausbau der AHV sicher gezieltere Verbesserungen erzielen als mit den anderen Säulen der Altersvorsorge, wobei zusätzlich die Frage von Beitragslücken in der AHV genauer analysiert werden müsste.
Erwähnte Quellen
Bude H. & Ph. Staab (2016). Kapitalismus und Ungleichheit. Die neuen Verwerfungen. Frankfurt/New York: Campus. Bundesamt für Statistik. (2014). Armut im Alter, Statistik der Schweiz. Bestellnummer 851-1201, Neuenburg. Leu, R.E., Burri, St. & Priester, T. (1997). Lebensqualität und Armut in der Schweiz. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt. Winkler, G. & Degele, N. (2010). Intersektionalität. Zur Analyse sozialer Ungleichheiten (2. Auflage). Bielefeld: transkript-Verlag. Heinrich Zwicky, Dozent am Institut für Vielfalt und gesellschaftliche Teilhabe, ZHAW Soziale Arbeit
Tagung mit hoher Aktualität und grossem Anklang
Mit der Gesetzgebung und der damit verbundenen politischen Diskussionen kommen neue Sichtweisen und unterschiedliche Lösungsverständnisse zum Vorschein. An der Tagung der ZHAW Soziale Arbeit und des Amtes für Jugend und Berufsberatung (AJB) wurde deshalb die Möglichkeit genutzt, um Geplantes gemeinsam zu bedenken – oder wie ein Referent treffend formulierte: «Wie lebt man ein neues Gesetz ohne bürokratische Übersteuerung?» Dass die Tagung bis auf den letzten Platz ausgebucht war, zeigt, dass die Fachwelt bereit ist, sich auf diese inhaltlich komplexen und fachlich hoch relevanten Diskussionen einzulassen.
Drei Referate mit drei Perspektiven auf das Thema
Nach der einleitenden Heranführung durch André Woodtli (Amtschef AJB) und Thomas Gabriel (Leiter des Instituts für Kindheit, Jugend und Familie der ZHAW) warfen die Referierenden Doris Bühler-Niederberger, Andreas Bernard und Rüdiger Kühn grundsätzliche Fragen zum Kindswohl, zum Familienbild und zum Institutionenverständnis in der Kinder- und Jugendhilfe auf. Die Soziologin Bühler-Niederberger problematisierte die auffällige Mütterzentrierung im Kindesschutz und das damit einhergehende Verschwinden des Kindes. Der Kulturwissenschaftler Bernard schlug einen Bogen über die neuzeitliche Entwicklung des Familienbildes und konfrontierte die Teilnehmenden mit überraschenden Effekten der Reproduktionsmedizin, die paradoxerweise ein idealisierendes und idealisiertes Bild von Familie zu verteidigen scheinen. Schliesslich zeigte Kühn anhand seiner Institution in Hamburg Möglichkeiten auf, die sich der Kinder- und Jugendhilfe bieten, wenn sie konsequent im gegebenen «Milieu» der Kinder und Jugendlichen stattfindet und dabei enge Kooperationen mit den Regelsystemen der Schule und der vorschulischen Einrichtungen sowie einer Vielzahl weiterer Akteure im unmittelbaren Sozialraum eingeht.
Workshops für eine vertiefte Auseinandersetzung
Im Anschluss an die Referate hatten die Tagungsteilnehmenden in sechs «file rouge»-Workshops die Gelegenheit, das Gehörte kritisch einzuordnen, zu vertiefen, zu hinterfragen und mit der eigenen Praxis in Verbindung zu bringen. Dabei wurden ideologische Muster, das professionelle Selbstverständnis und die Innovationsbereitschaft im Praxisalltag entlang der Themen «Wirkung», «Kontinuität und Diskontinuität» sowie «Denkmuster» angeregt diskutiert. Schliesslich hatten die Workshop-Gruppen in einem abschliessenden Podium die Möglichkeit, ihre zuvor erarbeiteten Kernthesen und -fragen den Referierenden zur Stellungnahme und erneuten Vertiefung vorzulegen.
Im Podiumsgespräch unter souveräner Leitung des Moderators Patrick Rohr wurde dann auch nochmals deutlich, dass das neue Kinder- und Jugendheimgesetz nicht «nur» eine Frage formaler Neuregulierungen ist, sondern Anlass bieten kann und soll, die fachlich-inhaltliche Auseinandersetzung über grundlegende Themen der Kinder- und Jugendhilfe zu führen. So verwies auch André Woodtli einleitend darauf, dass ein Gesetz dann gut komme, «wenn es die aktuelle Praxis ermöglicht und die nächste Praxis erlaubt. Dazu muss es dynamikrobust sein – ein dynamikrobustes Gesetz favorisiert Intentionen und Prinzipien und regelt die Zuständigkeit für das Festlegen von Regeln, statt diese Regeln bereits im Detail festzulegen».
Präsentationen zum Download
Prof. Dr. Doris Bühler-Niederberger, Universität Wuppertal (PDF 0.97 MB)Die Institutionen im Stresstest ‒ zwischen Flexibilisierung und Tradition?
Rüdiger Kühn, Geschäftsführer von SME, stadtteilbezogene milieunahe Erziehungshilfen, Hamburg (PDF 12.36 MB)
Probleme lösen – für die Praxis und mit der Praxis
Das TEP-Modul ist über ein Semester angelegt und umfasst einen strukturierten Projektbearbeitungsprozess in Zusammenarbeit mit einer Praxisorganisation oder einer Hochschule mit Bezug zur Sozialen Arbeit im In- und Ausland. Standardmässig bearbeiten zwei Studierende zusammen ein TEP-Projekt. Im Zentrum stehen die Akquise, Planung, Durchführung, Präsentation und Evaluation des Projekts.
Von der Gemeinwesenarbeit bis zu Mentoringprogrammen für Asylsuchende
Die im Herbstsemester durchgeführten Projekte widmeten sich einer grossen Bandbreite an Themen aus verschiedenen Handlungsfeldern: Sie reichten von der Systematisierung und Kategorisierung von Angeboten im Bereich der Gemeinwesenarbeit über die Entwicklung eines Konzepts für einen neuen Preis im Bereich der Soziokultur und die Erarbeitung von handlungsleitenden Empfehlungen für die Anwendung dialogischer Prinzipien in Projekten bis hin zu einer Bestandsaufnahme der Denk- und Handlungsmuster von Jugendarbeitenden gegenüber Rassismus und einer Bedarfsanalyse für Mentoringprogramme für unbegleitete minderjährige Asylsuchende.
Weiterführende Informationen

Patricia Koch hat im Rahmen der Veranstaltungsreihe «Um 6 im Kreis 5» der ZHAW zum Thema «Unbegleitete minderjährige Asylsuchende: Wie kann sich die Zivilgesellschaft einbringen?» referiert. Sie absolvierte ein Masterstudium in Sozialer Arbeit an der ZHAW.
Wie entstand die Idee, die Zivilgesellschaft in die Begleitung von jungen Asylsuchenden einzubeziehen?
Immer mehr Minderjährige kommen ohne Begleitung und Schutz ihrer Eltern in die Schweiz. Damit sie ihren Platz in der Gesellschaft finden, sind sie nebst einem pädagogischen Rahmen auch auf persönliche Beziehungen in der neuen Umgebung angewiesen. Zudem zeigen sich im Kontext der aktuellen Migrationskrise viele Menschen solidarisch und möchten sich freiwillig engagieren. Da liegt es nahe, diese beiden Bedürfnisse zusammenzuführen.
Wie gehen Sie dabei vor?
Im Rahmen unseres Projekts «+1 am Tisch» sind wir dabei, Netzwerke und Begleitstrukturen für Mentoring-Programme aufzubauen: Indem sie eine Vertrauensbeziehung schaffen und gemeinsame Momente verbringen, leisten die Mentorinnen und Mentoren einen Beitrag zum Wohlbefinden der jungen Flüchtlinge und fördern ihre Integration.
Welche Herausforderungen sehen Sie für die Freiwilligen?
Eine gewisse Flexibilität und gegenseitiges Interesse sind bei allen Beteiligten notwendig, da unterschiedliche Lebenswelten aufeinandertreffen. Beziehungen brauchen Zeit, um zu wachsen – so ist besonders am Anfang mit Zurückhaltung zu rechnen. Herausfordernd ist sicherlich auch die Konfrontation mit der oft schwierigen Realität von unbegleiteten Minderjährigen.
Wie stehen Sie zur Abgrenzung zwischen professioneller und freiwilliger Arbeit?
Ich sehe sie als komplementäre Herangehensweisen mit einem gemeinsamen Ziel: unbegleitete Minderjährige auf ihrem Weg zu einer Zukunftsperspektive zu unterstützen. Dabei hat professionelle Soziale Arbeit für die Einhaltung der Kinderrechte sowie für die Verwirklichung von Chancen zu sorgen. Zivilgesellschaftliches Engagement ergänzt diesen staatlichen Auftrag und trägt seinen Teil dazu bei, dass Integration auch auf der sozialen Ebene gelingt.
Welche Anforderungen stellt zivilgesellschaftliches Engagement an Sozialarbeitende?
Es braucht Mut und Gelassenheit in Bezug auf die eigene Rolle, um die Begleitaufgabe mit der Zivilgesellschaft zu teilen. Der Dialog über gegenseitige Erwartungen und eine aufmerksame Begleitung der Freiwilligen sind weitere Rahmenbedingungen für ein gelingendes Engagement.
Teresa S. stand mit beiden Beinen im Berufsleben, als bei ihr eine Netzhauterkrankung diagnostiziert wurde. Den Verdacht, dass etwas mit ihren Augen nicht mehr stimmte, hatte sie schon eine ganze Weile. Doch die Furcht vor der Diagnose hielt sie davon ab, früher einen Arzt aufzusuchen. Stattdessen blieb sie abends länger im Büro oder nahm Arbeit mit nach Hause. So kompensierte sie, dass sich ihr Sehvermögen schleichend verschlechterte und ihr das Arbeiten am Bildschirm nicht mehr so mühelos von der Hand ging wie früher. Erst als die Fehler deutlich zunahmen und sie zusehends gestresst wurde, zog sie die Konsequenzen und kündigte – ohne vorher mit ihrer Chefin über ihre Situation gesprochen zu haben.
Der fiktive Fall von Teresa S. basiert auf einem Interview aus einem interdisziplinären Forschungsprojekt der ZHAW Soziale Arbeit im Auftrag des Schweizerischen Zentralvereins für das Blindenwesen (SZB). Über die berufliche Situation von Menschen, die blind oder sehbehindert sind, war zuvor in der Schweiz nur wenig bekannt, insbesondere in Bezug auf die Integration dieser Bevölkerungsgruppe im ersten Arbeitsmarkt. SAMS, die Studie zum Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderung, erforschte zum einen diverse berufsbezogene Gleichstellungsaspekte und zum anderen die förderlichen und hinderlichen Faktoren für eine gelingende Integration im Beruf. Wie weit sind wir schon heute, wo besteht Handlungsbedarf und was kann und muss getan werden?
Die Soziale Arbeit gehört in den USA zu den Berufsfeldern mit dem grössten Wachstum: Das US Bureau of Labor Statistics (Amt für Arbeitsstatistik) geht bis 2020 von einem Plus von 25 Prozent aus. Derzeit verzeichnen die USA über 650 000 diplomierte Sozialarbeitende. Sie arbeiten im öffentlichen Dienst, in der Kinderhilfe, in Schulen, Krankenhäusern, Gefängnissen und Altersheimen. Die Sozialarbeitenden sind die landesweit grösste Berufsgruppe an Fachkräften im Bereich der geistigen Gesundheit. Sie sind somit zahlreicher als Psychiaterinnen, Psychologen und psychiatrische Krankenschwestern, die im klinischen Bereich tätig sind. Einer der grössten Arbeitgeber für Sozialarbeitende ist das US Department of Veterans Affairs (Ministerium für Veteranenangelegenheiten), das über 10'000 Mitarbeitende beschäftigt.
Die starke Zunahme an Sozialarbeitenden wirkt sich sowohl massgeblich auf die Unterstützungsangebote für die vulnerabelsten Mitglieder der Gesellschaft als auch auf die Gesetzgebung für entsprechende Programme und Dienstleistungen im Land aus. Veränderungen in der Gesellschaft wiederum schlagen sich in der Ausbildung und Praxis der Sozialen Arbeit nieder. Jüngste Entwicklungen zeigen einen Fokus auf Traumata – namentlich bei Kriegsveteranen –, integrierte Gesundheitsversorgung, Gewalt an Schulen und Arbeit mit älteren Menschen. Studierende der Sozialen Arbeit geben denn auch meist diese Handlungsfelder als Grund für ihre Berufswahl an.
Sie – das sind alte Menschen mit Sehbehinderung. Im Alltag haben sie mit allerhand Widrigkeiten zu kämpfen – das stark eingeschränkte Sehvermögen selbst ist nur eine davon. Dazu kommt, dass ihr Umfeld oft viel zu wenig auf sie ausgerichtet ist, was ihre Chancen auf Teilhabe zusätzlich mindert. Das Kompetenzzentrum für Sehbehinderung im Alter (KSiA) hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Möglichkeiten von alten Menschen mit Sehbehinderung auszuschöpfen und ihre Selbstbestimmung zu erhöhen.
Die Büroräumlichkeiten des KSiA sind eine umfunktionierte Wohnung im Zürcher Kreis 2. Dass die drei Mitarbeiterinnen sich als Arbeitsplatz eine Wohnung teilen, passt gut. Denn ihre Zusammenarbeit ist mehr als eine berufliche Zweckgemeinschaft, ihr Umgang miteinander zeugt von Wertschätzung, Teamgeist und viel Vertrautheit. Fatima Heussler, Magdalena Seibl und Judith Wildi setzen sich mit Engagement für ein Anliegen ein, das ihnen am Herzen liegt – und das verbindet.

Thomas Gabriel, worin lag die Notwendigkeit einer neuen Gesetzgebung begründet?
Das aktuell geltende Gesetz über die Jugendheime und die Pflegekinderfürsorge ist über fünfzig Jahre alt. Es ist weder den heutigen gesellschaftlichen Verhältnissen angemessen, noch lässt es sich mit den Ansprüchen an moderne und zeitgemässe Kinder- und Jugendhilfesysteme vereinbaren. In den vergangenen fünfzig Jahren hat sich zudem die Gesetzeslage auf der Ebene des Bundes und auf der kantonalen Ebene stark verändert (u.a. Pflegekinderverordnung PAVO, Volksschulgesetz, Sozialhilfegesetz, Einführungsgesetz zum Kindes- und Erwachsenenschutzrecht). Dies hat eine Vielzahl an Schnittstellenfragen und unklaren Zuständigkeiten hervorgebracht, die das neue KJG regelt.
Was bedeutet das neue Gesetz für die betroffenen Kinder und Jugendlichen?
Für die betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie ihre Familien ist es ein grosser Fortschritt, dass ambulante und stationäre Hilfen im selben Gesetz und nach den gleichen finanziellen Prämissen geregelt werden. Die bisherige strenge formelle Unterscheidung zwischen ambulanter und stationärer Kinder- und Jugendhilfe wird zugunsten einer Flexibilisierung der Angebote aufgegeben. Die Angebote können dadurch besser auf die Bedürfnisse der Heranwachsenden und ihrer Familien abgestimmt werden.
Das neue KJG zielt auf die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Jugendhilfeangebots im Kanton Zürich ab. Die Situation aller Kinder und Jugendlichen ‒ aber insbesondere der gefährdeten Heranwachsenden ‒ wird damit ein zentraler Bezugspunkt der zukünftigen Versorgungssteuerung. Damit wird das neue KJG auch der Empfehlung der UN Kinderrechtskonvention an die Schweiz gerecht, die Sammlung von Daten zur Situation der Kinder in allen Bereichen der Kinderrechtskonvention «unverzüglich zu verbessern».
Wo sehen Sie Chancen und Herausforderungen für Fachleute der Sozialen Arbeit?
Die Flexibilisierung traditioneller Jugendhilfemassnahmen und die Entwicklung neuer Angebote an ergänzenden Hilfen zur Erziehung sind eine Chance und eine fachliche Herausforderung für die Soziale Arbeit. Hier kann viel aus den Erfahrungen anderer europäischer Länder gelernt werden, falls sie sorgsam interpretiert werden. Der Anspruch einer fachlichen Steuerung der Jugendhilfe ist zudem immer auch gegen ökonomische und politische Interessen abzuwägen. Es braucht gute Argumente, um die Interessen und Bedürfnisse der Kindern und Jugendlichen sichtbar zu machen und auch die passenden Hilfsangebote zu entwickeln.
Wo sehen Sie die Rolle der Hochschule in diesem Diskurs?
Unsere Hochschule hat die Rolle eines «critical friend», der Entwicklungen begleitet und vorhandenes Wissen im Dialog mit der Praxis und den Entscheidungsträgern in Amt und Politik zur Verfügung stellt. Der heikle Aspekt besteht darin, den «friends» auch unbequeme Fragen zu stellen. Beispielsweise dazu, wie nachhaltig die Effekte der Jugendhilfe sind und ob die Perspektive der Kinder und Jugendlichen bei Platzierungen ausreichend einbezogen wird. Diese kritische Haltung ist jedoch nicht Selbstzweck: Ihr Ziel ist vielmehr eine gemeinsame Weiterentwicklung der Praxis und Theorie der Kinder- und Jugendhilfe.
3000. So lautet die Zahl der Urteile, die pro Jahr beim Justizvollzug im Kanton Zürich eingehen. Der Kernauftrag der Hauptabteilung Bewährungs- und Vollzugsdienste (BVD) wird bereits aus dem Namen deutlich. Vollzug, das kann Einweisung ins Gefängnis oder in eine stationäre Therapie bedeuten. Die Bewährungshilfe setzt mit der bedingten Entlassung an. Daneben führen die BVD im Auftrag der Staatsanwaltschaften verhaltensorientierte Lernprogramme in Gruppen durch. Zur Zielgruppe gehört, wer sich eines Strassenverkehrs-, Vermögens- oder Gewaltdelikts, insbesondere häuslicher Gewalt, strafbar gemacht hat.
Die Hauptabteilung mit 140 Mitarbeitenden ist interdisziplinär zusammengesetzt: Sie besteht aus 45 Sozialarbeitenden, 15 Juristinnen und Juristen, 10 Psychologinnen und Psychologen sowie rund 70 Mitarbeitenden aus verschiedenen Verwaltungsberufen. Support erhalten alle Fallverantwortlichen über die jeweiligen Vorgesetzten sowie vom internen Rechtsdienst und seit 2010 von der Abteilung für forensisch-psychologische Abklärungen.
Der Preis wurde Klaus Mayer am 2. November 2016 von der Präsidentin der SGRP, Leena Hässig Ramming, überreicht. Klaus Mayer erhält ihn für seine Leistungen bei der Konzeptualisierung und Implementierung des Risikoorientierten Sanktionenvollzugs (ROS).
Mehr Übergriffe, härtere Gesetze?
Übergriffe gegen Polizistinnen und Polizisten haben zugenommen. Laut der Schweizer Kriminalstatistik hat sich die Zahl seit dem Jahr 2000 fast vervierfacht: sei das mit Steinen, Laserpointern, Petarden oder verbal. Die Stadtpolizei und das Polizeidepartement Zürich haben deshalb bereits im vergangenen Jahr die Arbeitsgruppe PIUS (Polizeiarbeit in urbanen Spannungsfeldern) gegründet. Sie soll diese Entwicklung erklären und mögliche Massnahmen vorschlagen. Vor diesem Hintergrund mag die Haltung von Dirk Baier (Leiter Institut für Delinquenz und Kriminalprävention ZHAW) überraschen. Er vertritt die Meinung: «Die Gesellschaft wird nicht generell respektloser, es braucht daher auch keine verschärften Gesetze.»
Wie er seine Aussage begründet und welche Ansichten Daniel Kindlimann (Winterthurer Stadtpolizist), Markus Mohler (Polizeiexperte und ehemaliger Basler Polizeikommandant) und Daniel Kloiber (Leitender Staatsanwalt der Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl) in die Diskussion einbringen, erfahren Sie in der Sendung.
Eckdaten zur Studie
Die Studie beschäftigte sich mit der Arbeitssituation von Personen, deren erste berufliche Integration bereits abgeschlossen ist und die auch mit Brille oder Kontaktlinsen nur mit starken Schwierigkeiten oder gar nicht in der Lage sind, ein Buch oder eine Zeitung zu lesen, und die sich nicht oder nur mit starken Schwierigkeiten in einer Umgebung orientieren und Gesichter erkennen können. SAMS besteht aus einer Vorstudie, fünf aufeinander folgenden Modulen sowie zwei Workshops mit Betroffenen. Die Module umfassten standardisierte telefonische sowie leitfadengestützte persönliche Interviews mit Personen, die blind oder sehbehindert sind, die Aufarbeitung des nationalen und internationalen Forschungsstands, eine Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, Gruppendiskussionen mit Arbeitgebenden, einen Vergleich mit Daten aus der Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung und anderen statistischen Erhebungen sowie eine vertiefende qualitative Analyse von erfolgreichen und weniger erfolgreichen Berufsverläufen. Dieses umfassende Vorgehen stellte sicher, dass verschiedene Perspektiven zum Tragen kamen.
Traumata als sozialarbeiterische Herausforderung
Mit einer zunehmenden Fokussierung auf die Rolle von Traumata in der Lebensgestaltung von Menschen ist die Soziale Arbeit je länger, je stärker gefordert, sich mit den psychologischen und sozialen Hintergründen dieser klinischen Diagnose und ihren verheerenden Folgen auf das Leben der Klientinnen und Klienten auseinanderzusetzen. Die Fachliteratur befasst sich immer mehr mit Themen wie posttraumatischer Belastungsstörung und Handeln vor dem Hintergrund von Traumata. Es werden Stimmen laut, wonach diesen Themen im Curriculum auf Bachelor- und Masterstufe mehr Gewicht gegeben werden soll. Sozialarbeitende wenden ihr diesbezügliches Wissen auf den gesamten Lebenszyklus ihrer Klientinnen und Klienten jeden Alters an, insbesondere jedoch bei der Arbeit mit Kindern, Familien, älteren Menschen und Kriegsveteranen. Soldaten, die aus Kriegsgebieten wie Irak und Afghanistan zurückkehren, müssen lernen, mit Folgeeffekten aus ihrer Kampferfahrung umzugehen. Sozialarbeitende werden daher zunehmend mit posttraumatischen Belastungsstörungen und Schädel-Hirn-Traumata konfrontiert sowie mit weiteren psychologischen und physischen Traumata im Zusammenhang mit dem Einsatz von improvisierten Sprengkörpern. Es wird debattiert, dass Sozialarbeitende auf die steigenden Bedürfnisse in Bezug auf psychische und drogenbedingte Probleme von Kriegsveteranen und deren Familien vorbereitet werden müssen, da der Umgang der Sozialen Arbeit mit diesen Problemen einen massgebenden Einfluss auf die Effektivität der psychiatrischen Versorgung generell habe.
Von der Pflegefachfrau zur Mitgründerin
Judith Wildi ist im KSiA für den Bereich Bildung zuständig. Die sympathische Frau mit den vifen Augen und der aufrechten Haltung spricht klar, auf den Punkt und mit bedachten Gesten. Angefangen hat sie ihre berufliche Laufbahn als Pflegefachfrau, das Unterrichten habe sie aber immer schon gereizt, darum auch die Ausbildung zur Berufsschullehrerin für Gesundheits- und Krankenpflege. Nach verschiedenen Stationen ‒ unter anderem als Lehrerin und Bereichsleiterin in einer Berufsschule ‒ begann 2010 mit ihrer Tätigkeit in der Stiftung Mühlehalde die intensive Auseinandersetzung mit dem Thema Sehbehinderung im Alter. Ein Thema, das sie nicht nur aus der pflegerischen Perspektive, sondern auch aus Sicht der Sozialen Arbeit angehen wollte. Darum folgten Weiterbildungen an der ZHAW Soziale Arbeit in sozialer und psychosozialer Gerontologie mit dem Ziel, den Master in Sozialer Gerontologie zu absolvieren. Im August 2012 gründete sie mit ihren beiden Kolleginnen das KSiA, um fortan das Thema Sehbehinderung im Alter sichtbar zu machen und zu vermitteln.
Rückfallprävention und Risikoorientierung – kein Gegensatz
Hans-Jürg Patzen ist Leiter der Bewährungs- und Vollzugsdienste. Als er 1993 seine Laufbahn als Sozialarbeiter im Justizvollzug begann, habe man fast ausschliesslich die Resozialisierung als Methode in der Kriminalprävention gelten lassen. «Heute ist man schlauer», sagt er und spricht dabei die Risikoorientierung an. Sie basiert auf dem Risk-Need-Responsivity-Modell von Andrews und Bonta (2007), das im Modellversuch Risikoorientierter Sanktionenvollzug (ROS) zwischen 2010 und 2013 in den Kantonen Zürich, St. Gallen, Thurgau und Luzern mit Erfolg erprobt und schliesslich zum Qualitätsstandard in den erwähnten Kantonen erklärt wurde. Hans-Jürg Patzen bezieht sich bei seiner Einschätzung auf Erkenntnisse aus der Rückfallforschung und auf die bescheidene Erfolgsquote der (Re-)Sozialisierungsbemühungen. Diese sei wesentlich darauf zurückzuführen, dass die Bemühungen fast ausschliesslich und wenig individualisiert (ohne eingehendes Assessment) beim Straffälligen angesetzt hätten und die Ressourcenbereitstellung in der Sozialstruktur eines Gemeinwesens nahezu unberücksichtigt liessen. «Sozialarbeit mit Straffälligen ist aber immer auch Gemeinwesenarbeit», erläutert Hans-Jürg Patzen: «Arbeit für eine differenzierte und auf Chancenbildung ausgerichtete Sozialstruktur für Straftäter und Straftäterinnen.»
Evidenzbasierte Kriminalprävention verlangt eine individuelle, persönlichkeitsbezogene und soziale Befunderhebung. Darauf legt die Risikoorientierung nach dem ROS-Modell ihren Fokus. Sie beschäftigt sich mit der Person, ihren Ressourcen, ihren Risikomerkmalen und ihrer Lebenslage. Davon ausgehend sind der Bedarf für Beratung und Interventionen sowie Therapie und Betreuung wie auch die Bereitstellung von stützenden Strukturen und von Kontrollen festzulegen. Der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen forensischen Psychologen, Sozialarbeitenden, Juristinnen und Verwaltungsangestellten kommt dabei eine zentrale Rolle zu. Haben alle ein klares Verständnis davon, was zu tun und was zu lassen ist? Hans-Jürg Patzen sieht gerade bei diesem Punkt Weiterbildungsbedarf und verweist auf die Angebote der ZHAW für Sozialarbeitende in der Justiz. Um die Methoden der Risikoorientierung und der darauf neu aufgesetzten Resozialisierung im interdisziplinär angelegten Arbeitsfeld erfolgreich umsetzen zu können, sind Bildung und Weiterbildung erforderlich. «Ohne sie schafft man im Justizvollzug und in der Sozialarbeit keine neuen Qualitäten», ist Hans-Jürg Patzen überzeugt. Zudem müssen sich Dienste und Einrichtungen der Justiz den veränderten methodischen Konzeptionen und Anforderungen gegenüber öffnen und dafür sorgen, dass der Wissenstransfer zwischen Forschung, Lehre und Praxis einfacher werde: im Interesse der Kriminal- und Deliktprävention und schliesslich im Interesse eines wirksamen Opferschutzes. Es ist Hans-Jürg Patzen wichtig zu betonen, dass individualisierte Rückfallprävention und Risikoorientierung keine Dualität darstellen, sich nicht gegenseitig ausschliessen, sondern notwendigerweise ergänzen.
Seit mehr als zwanzig Jahren herrschen in der Bevölkerung eine ausgeprägte Kriminalitätsfurcht und die Erwartung, dass Kriminalität mit drakonischen Strafen bekämpft werde. Politische Vorstösse und Volksabstimmungen spiegeln diese Angst, und die etablierte Politik reagiere darauf wie auch auf Rückfälle mit Vorstössen zur weiteren Einengung der im Strafgesetzbuch angelegten Resozialisierung. «In diesem Spannungsfeld muss sich der Justizvollzug zurechtfinden», erläutert Hans-Jürg Patzen und verweist auf die rechtlichen Grundlagen, auf die sich der Justizvollzug stützt beim Erbringen von Leistungen und beim Treffen von Entscheidungen, sowie auf Forschungsergebnisse, die zeigen, dass drakonische Strafvollzugssysteme nicht zum Ziel führen, ja die Rückfälligkeit begünstigen. «Es führt kein Weg an einer Differenzierung vorbei, die fachlich einwandfrei gestützt und geprüft ist», meint Hans-Jürg Patzen. Hier komme auch die Bildungsinvestition der ZHAW zum Tragen. «Fachliche Qualität ist letztlich immer Bildungsinvestition», ist Hans-Jürg Patzen überzeugt. Der Weg von der wissenschaftlichen Erkenntnis in die Praxis sei lang, in diesem Prozess seien die Hochschulen wichtig.
Das «ROS-Konzept»
ROS geht davon aus, dass die Resozialisierung Straffälliger nur durch die gezielte Senkung ihres Rückfallrisikos und die gleichzeitige Stärkung ihrer Ressourcen gelingen kann. In einem integrierten Prozess systematisiert und strukturiert ROS die Arbeit mit Straffälligen und nutzt dabei bewährte wissenschaftliche Erkenntnisse. Das Konzept wurde zunächst in vier Kantonen unter Federführung des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich getestet. Mittlerweile wurde es von weiteren Kantonen übernommen.
Naheliegendes und Unerwartetes
Die Studie hat zum einen verbreitete Vermutungen bestätigt, aber auch Überraschendes zutage gebracht. So ist beispielsweise nicht weiter verwunderlich, dass die Berufschancen mit der Qualifikation der Ausbildung steigen. Dass Männer mit Sehbehinderung offenbar bessere Berufschancen haben als Frauen mit derselben Behinderung, erscheint jedoch nicht zwingend. Und wer hätte gedacht, dass Menschen mit Sehbehinderung, die den Einstieg in den ersten Arbeitsmarkt geschafft haben, in vielen der untersuchten Aspekte gleich oder gar besser abschneiden als die Schweizer Gesamtbevölkerung? So zum Beispiel in Bezug auf ihren Anteil an Angestellten mit einem monatlichen Einkommen von 7000 Franken oder mehr sowie auf die Dauerhaftigkeit der Anstellung. Gleichstellung ist jedoch nicht erreicht hinsichtlich des Beschäftigungsgrades. So sind Menschen mit Sehbehinderung häufiger ungewollt in einem Teilzeitarbeitsverhältnis angestellt als die Schweizer Gesamtbevölkerung – zwei Drittel der Teilzeitbeschäftigten gaben an, aufgrund ihrer Sehbehinderung Teilzeit zu arbeiten. Sehr wichtig ist die Erkenntnis, dass Personen mit Sehbehinderung seltener berufliche Weiterbildungen wahrnehmen. Dies zum einen, weil das Angebot eingeschränkt ist oder die Teilnahme mühsam erkämpft werden muss, zum anderen, weil sie schon stark damit beschäftigt sind, sich in Bereichen schulen zu lassen, die ihnen die Arbeit ermöglichen oder erleichtern. Positiv zu werten ist die grosse berufliche Vielfalt der Studienteilnehmenden: Sie reicht von Journalistin über Buchhalter und Physiotherapeut bis Lehrerin und Sozialarbeiter.
Folgen des Babybooms
Ein weiterer Bereich, in dem Sozialarbeitende zunehmend gefordert sind, betrifft Angebote für ältere Menschen. Als 2011 die ersten Babyboomer (zwischen 1945 und 1964 Geborene) das Alter von 65 erreichten, begann der Bevölkerungsanteil älterer Menschen massiv anzusteigen. Bis 2050 wird beinahe eine Verdoppelung des Anteils an Menschen erwartet, die 65 und älter sind – von derzeit 43 Millionen auf 83 Millionen Menschen. Die jüngsten Babyboomer werden dann über 85 sein und ein hohes Mass an Betreuung und Pflege benötigen. Im Rahmen der Altersarbeit sind Sozialarbeitende damit konfrontiert, mit spezifischen Bevölkerungsschichten umzugehen, beispielsweise mit Menschen mit gesundheitlichen oder psychischen Beeinträchtigungen, in der Palliative Care oder mit älteren erwachsenen Einwandererinnen und Einwanderern. Ein Trend geht dahin, dass die Angebote auch die Gemeinschaft einbeziehen und dadurch massgebliche Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes haben. Sozialarbeitende verfügen über Wissen und spezifische Methoden, um den Bedürfnissen älterer Menschen gerecht zu werden, und die Soziale Arbeit als Profession ist in der Lage, sich zu entwickeln und sich den Bedürfnissen dieser Zielgruppe anzupassen. Vor dem Hintergrund der höheren Lebenserwartung aufgrund von technischem und medizinischem Fortschritt sind Sozialarbeitende gefordert, die damit einhergehenden Auswirkungen auf die Bevölkerung und Gemeinschaften zu erkennen und zu bearbeiten. Neben der Unterstützung von Einzelpersonen beim Bewältigen ihres Alltags ist es ihre Aufgabe, Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Gemeinschaften, deren Bedürfnisse sich stetig verändern, zur Seite zu stehen.
Schulungen mit Aha-Erlebnis
Der Bereich Bildung des KSiA beinhaltet auch Schulungen für Personal in Langzeitinstitutionen: aus der Pflege und der Sozialarbeit – und von der Hauswirtschaft über die Administration bis zur Küche. Sie dauern von zwei Stunden bis mehrere Tage. In den Kursen geht es um Sensibilisierung durch Selbsterfahrung mit Simulationsübungen und um die fachliche Erweiterung sehbehinderungsspezifischer Kompetenzen. Die Erfahrung, mit eingeschränktem Sehvermögen einen weissen Teller mit farblich nicht abgestimmtem Essen auf einem weissen Tischtuch vorgesetzt zu bekommen, hat schon manches Aha-Erlebnis beschert. Kein Wunder, vergeht manch älteren Menschen die Lust am Essen. Die Schulungen vermitteln Zusammenhänge und konkrete Handlungsansätze: Was macht es alten Menschen mit Sehbehinderung leichter, sich zurechtzufinden und mit wiedergewonnener Selbständigkeit ihre Situation umfassend zu verbessern?
Tagung
An der Tagung «Wer A sagt, muss B denken. Themen zum neuen Kinder- und Jugendheimgesetz im Disput» vom 2. Februar 2017 werden ausgewählte Aspekte zum neuen Gesetz kontrovers diskutiert. Angesprochen sind Fachleute des AJB, der sozialpädagogischen Einrichtungen, weitere vom neuen Gesetz Betroffene sowie Dozierende und Forschende.
Soziale Arbeit ist immer auch Handwerk
Hans-Jürg Patzen ist es ein Anliegen, die Arbeit der BVD laufend den aktuellen Bedürfnissen und Entwicklungen anzupassen. Soziale Arbeit ist der einzelnen Person sowie Gruppen verpflichtet und muss stets auch helfen, die Sozialstruktur weiterzuentwickeln. Unverändert wichtig seien auch konkrete Hilfestellungen wie beispielsweise die Abteilung Schuldensanierung der BVD. Hans-Jürg Patzen bezeichnet die Sanierung der Finanzen als höchst wirksamen Beitrag für die soziale Integration und für das Erlangen der finanziellen Selbstständigkeit ohne Schulden. Im Kontext der Arbeitsintegration beispielsweise sei man sehr gut darin, die Situation zu verstehen, an konkreten Einstiegsmöglichkeiten fehle es aber zum Teil. Das RAV und weitere Institutionen leisten für viele Beratung und Vermittlung, doch gerade bei Menschen, die lange Zeit im Vollzug waren, sei der Anschluss an die Arbeitswelt unverändert schwierig. Es müssen weitere Investitionen geprüft werden. Deshalb erachtet Hans-Jürg Patzen die Gemeinwesenorientierung als zentral. Soziale Arbeit müsse das Gemeinwesen im Blick halten: Wo funktionieren Anschlusslösungen, wo sind die Schwellen zu hoch? Diese Schnittstellen und Barrieren gelte es zu bearbeiten und nicht einfach zu verwalten. Ihm sei die Soziale Arbeit manchmal zu wenig konturiert, gibt Hans-Jürg Patzen an: «Es muss jeweils klar sein, was bei der einzelnen Person angezeigt ist und worauf sie anspricht. Ausgehend vom Befund ist konsequent zu klären, wer was zu tun hat. Dann gilt es zu schauen, ob es in der geforderten Qualität ausgeführt wird und was es beim Klienten bewirkt.» Soziale Arbeit sei immer auch Handwerk, das auf einer soliden Fachkonzeption aufbaue, Netzwerke betreibe und die interdisziplinäre Zusammenarbeit begünstige.
Hans-Jürg Patzen ist Hauptabteilungsleiter Bewährungs- und Vollzugsdienste des Amts für Justizvollzug des Kantons Zürich.
Aus der Laudatio
In der Laudatio heisst es: Mit ROS «wurde eine Begrifflichkeit eingeführt, die interdisziplinäres Arbeiten erleichtert, und es wurde Transparenz geschaffen, indem Behandlungsziele klar operationalisiert wurden. Für die Praxis bedeutet das: Leichter verstehbare und auch besser kritisierbare Therapieberichte […]. Klaus Mayer ist es dabei gelungen, den Justizvollzug im Allgemeinen und die Praxis der forensischen Psychologie im Besonderen wissenschaftlicher zu gestalten und damit einhergehend die Grundlagen für eine fairere sowie auch sicherere Vollzugspraxis zu schaffen.»
Der Leiter des Instituts für Delinquenz und Kriminalprävention, Dirk Baier, sagt zur Preisverleihung: «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Instituts beglückwünschen Klaus Mayer. Wir freuen uns, dass seine intensive Arbeit am ROS-Konzept in dieser Form eine Würdigung erfährt. Klaus Mayer hat ROS mitentwickelt und an seiner Umsetzung mitgewirkt. Zugleich führt er im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen in das Konzept sowie seine Hintergründe und Anwendungen ein. Für seine vielfältigen Leistungen in Bezug auf das ROS-Konzept aber auch am Institut sind wir ihm sehr dankbar.»
Vorurteile als Hindernis – Wissen als Chance
Ein wesentlicher hemmender Faktor für die Integration von Menschen mit Sehbehinderung im Beruf sind die Vorurteile der Arbeitgebenden. Dem Zufall kommt demnach eine hohe Bedeutung zu – gerade bei Mitarbeitenden wie Teresa S., die im Laufe ihres Berufslebens an einer Sehschwäche erkranken: Wie empfänglich sind die Vorgesetzten, wie gross ihre Bereitschaft, sich zu erkundigen und nicht vor Umstellungen zurückzuschrecken? Aber auch bei Menschen, die von Geburt an eine Sehbehinderung haben, entscheiden die Offenheit und der Wissensstand der (potenziellen) Arbeitgebenden massgeblich über ihre Anstellung und Berufschancen. In beiden Fällen empfehlen sich eine proaktive Kommunikation der betroffenen Personen über ihre Sehbehinderung sowie eine höhere Sensibilisierung des Arbeitsumfelds: So können auf allen Seiten Unsicherheiten ausgeräumt werden und die Chancen, dass assistierende Technologien bereitgestellt und genutzt werden, steigen ebenfalls. Neben Fällen wie dem von Teresa S. gewann das Projektteam auch Einblicke in das Arbeitsleben von Menschen mit Sehbehinderung, bei denen die Vorgesetzten mit ihrer Haltung entscheidend zur gelungenen Integration beitrugen: Vorgesetzte, die sich erkundigten, wer Hilfe bietet und wie die betroffene Person am besten unterstützt werden kann, die den Einbezug ins Team förderten und so die Integration zur Aufgabe aller Beteiligten machten.
Text/Übersetzung
von Anwar Najor-Durack und Jerrold R. Brandell
(aus dem Englischen von Nicole Barp)
Dr. Anwar Najor-Durack, Licensed Master Social Worker, ist Leiterin Field Education und Assistenzprofessorin am Departement Soziale Arbeit der Wayne State University in Detroit, Michigan.
Dr. Jerrold R. Brandell, Licensed Master Social Worker, ist stellvertretender Dekan für Academic Affairs ad interim und Professor am Departement Soziale Arbeit der Wayne State University in Detroit, Michigan
Demenz oder Sehbehinderung?
Etwa 30 Prozent der Menschen über 80 Jahre haben eine Sehbehinderung. Doch in vielen Fällen wird diese nicht erkannt, denn die Symptome ähneln denen einer Demenz. Zum einen ergänzt das Hirn bei einem Gesichtsfeldausfall fehlende Informationen, zum anderen kann es bei Sehschädigungen visuelle Bilder, also Halluzinationen, produzieren. In beiden Fällen deckt sich die Wahrnehmung der sehgeschädigten Person nicht mit der Realität – sie scheint zu fabulieren und wird für dement gehalten. «Interessant ist, dass die Halluzinationen selbst keine Ängste auslösen, wohl aber die Reaktionen der Mitmenschen. Darum ist es so wichtig, dass das Umfeld begreift, was vor sich geht, und mit Verständnis und Erklärungen reagiert statt mit Ungeduld oder Verärgerung», erklärt Judith Wildi. Je mehr sie das Thema ausführt, desto deutlicher wird, dass sie ihre Arbeit nicht als Job, sondern als Lebensaufgabe versteht. Sie fordert, dass bei älteren Menschen genaue ophthalmologische Abklärungen getroffen werden. Diese sollen Aufschluss darüber geben, ob tatsächlich eine Demenz oder nicht doch eine Sehbehinderung vorliegt. Die richtige Diagnose und die damit verbundene Betreuung, Pflege und Aktivierung würde die Lebensqualität der betroffenen Personen massiv erhöhen.
Details zur Tagung
Weiterbildungen am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention
Das Institut für Delinquenz und Kriminalprävention der ZHAW Soziale Arbeit bietet verschiedene Weiterbildungen an: Kurse, Certificates of Advanced Studies CAS und einen Master of Advanced Studies MAS. Dank der engen Zusammenarbeit mit der Praxis werden neue Entwicklungen wahrgenommen und fliessen über Forschungserkenntnisse in den Lehrplan ein. Beim CAS Rückfallprävention und beim CAS Soziale Integration hat das Amt für Justizvollzug bei der Konzeption und Umsetzung mitgewirkt. Die beiden Weiterbildungen lassen sich zu einem MAS in Dissozialität, Delinquenz, Kriminalität und Integration ausbauen.
Weiterbildungen am Institut für Delinquenz und Kriminalprävention
Weitere Informationen
Vom SZB abgeleitete Massnahmen
Die Erkenntnisse aus der Studie sollen es Organisationen des Sehbehindertenwesens ermöglichen, Massnahmen abzuleiten. Mithilfe dieser Massnahmen sollen bestehende Hindernisse und Barrieren vermindert oder beseitigt werden, damit Personen mit Sehbehinderung Chancen auf ein dauerhaftes und möglichst gleichgestelltes Berufsleben haben. So hat der SZB in seiner Fachpublikation «Beruflich am Ball bleiben: mit Sehbehinderung» verschiedene Massnahmen für Arbeitgebende, Betroffene und Fachstellen abgeleitet und das Info-Set «Gut im Job» herausgegeben. Bezogen auf (potenzielle) Arbeitgebende sei vor allem Sensibilisierung nötig, um Vorurteile und Hemmschwellen abzubauen. Oft wissen Vorgesetzte nämlich gar nicht, welche assistierenden Technologien verfügbar sind und welche Tätigkeiten Menschen mit Sehbehinderung ausführen können. Wichtig sei auch, auf die Kompetenzen der Menschen mit Sehbehinderung zu fokussieren, anstatt sie auf ihre Einschränkung zu reduzieren. Diese und weitere Tipps werden nun auf der bereits bestehenden Integrationsplattform für Arbeitgebende www.compasso.ch zugänglich gemacht. Personen mit Sehbehinderung selbst wird geraten, offen zu kommunizieren. Wie gehe ich eine Aufgabe an? Welche Hilfsmittel benötige ich dafür? Auf Sehbehinderung spezialisierte Stellen ihrerseits sind aufgefordert, die Wichtigkeit offener Kommunikation zu betonen und mit den betroffenen Personen Kommunikationsstrategien zu entwerfen. Der SZB bietet dazu einen Kurs für Fachleute an. Für alle Personengruppen ist zentral, berufsbezogene Weiterbildungen zu ermöglichen, einzufordern respektive zu empfehlen.
Sind Sie an der Arbeit mit älteren Menschen interessiert?
Dann finden Sie hier die Weiterbildungsmöglichkeiten in sozialer Gerontologie.
Einsatzstärke auf jedem Parkett
Davon, dass Judith Wildi gerne mit vollem Einsatz im Team an etwas arbeitet, zeugt auch ihr Privatleben: Anders hätten sie und ihre Partnerin es nicht an die Spitze der Schweizer Equality-Tanzszene geschafft. Sich gemeinsam bewegen und hartnäckig am Detail arbeiten, das sagt der engagierten Frau zu. Ihre Begeisterung für das Ausschöpfen der Möglichkeiten alter Menschen und fürs Tanzen konnte sie im CAS Soziale Gerontologie wunderbar miteinander verbinden – mit einer Abschlussarbeit zum Tanzcafé von Verena Speck, bei dem alte Menschen sich einmal im Monat zum Tanz treffen. Auch hier steht die Erweiterung des sozialen Radius im Zentrum. Denn eins will Judith Wildi ganz bestimmt nicht hören: den resignierten Satz nach dem Besuch beim Augenarzt «Da kann man halt nichts mehr machen».
Auf gutem Weg
Die Studie hat gezeigt: Es wurde bereits sehr viel erreicht, seit 1953 in der Schweiz ein erster Telefonistenkurs für Menschen mit Sehbehinderung angeboten wurde. Und durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebenden, Teammitgliedern, Fachstellen und Betroffenen ist noch weit mehr möglich. Berufsverläufe, die an der Kommunikation scheitern wie der von Teresa S., können und müssen vermieden werden. Dazu wollen die Studie der ZHAW sowie die Publikation und das Info-Set des SZB beitragen.
Master of Advanced Studies (MAS) in Sozialer Gerontologie
Wie können alte Menschen in stationären Einrichtungen optimal betreut werden? Welche unterschiedlichen Arbeitsweisen, Interventionsmethoden und Betreuungskonzepte steigern die Lebensqualität aller Beteiligten? Der neue MAS in Sozialer Gerontologie vermittelt fundiertes Wissen aus den gerontologischen Handlungsfeldern und fördert eine praxisbezogene und anwendungsorientierte Auseinandersetzung mit relevanten Themen der sozialen Altersarbeit.
Projektteam:
Sylvie Johner-Kobi, ZHAW Soziale Arbeit
Anna Maria Riedi, ZHAW Soziale Arbeit
Susanne Nef, ZHAW Soziale Arbeit
Verena Biehl, ZHAW Gesundheit
Julie Page, ZHAW Gesundheit
Alireza Darvishy, ZHAW School of Engineering
Stephan Roth, ZHAW School of Engineering
Sylvie Meyer, HES-SO, Haute école de travail social et de la santé
Eylem Copur, ZHAW School of Management and Law
Schweizerischer Zentralverein für das Blindenwesen SZB
Der SZB setzt sich seit 1903 dafür ein, dass taubblinde, blinde und sehbehinderte Menschen ihr Leben selbst bestimmen und in eigener Verantwortung gestalten können. Er berät Betroffene, bietet ihnen Schulungen an, vertreibt Hilfsmittel und stellt Fachliteratur bereit. Zudem leistet er Aufklärungsarbeit in der Öffentlichkeit sowie in Institutionen und treibt die Forschung voran.
An der Studie Beteiligte
Die Studie wurde von vier Departementen der ZHAW (Soziale Arbeit, Gesundheit, School of Management and Law, School of Engineering) in Zusammenarbeit mit der HES-SO realisiert. Dabei wurden sie eng begleitet vom SZB und einer Begleitgruppe, in der die zentralen Verbände des Sehbehindertenwesens sowie Vertreterinnen und Vertreter von Beratungsstellen und der Invalidenversicherung mitwirkten. Finanziert wurde SAMS vom Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, dem Migros Kulturprozent sowie dem SZB und seinen Mitgliedsorganisationen.