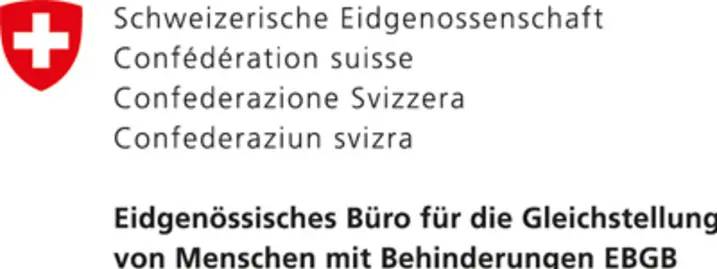Gleichberechtigte Mobilität dank ÖV-ergänzender Fahrdienste?
ÖV-ergänzende Fahrdienste sind für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen wichtig. Dennoch ist das Angebot für die Betroffenen oft begrenzt und teuer. Dieses Projekt erfasst die Erfahrungen von Menschen mit Mobilitätseinschränkungen mit dem Zweck, Grundlagen für die Verbesserung ÖV-ergänzender Angebote zu schaffen.
Ausgangslage
Viele Menschen in der Schweiz können den öffentlichen Verkehr (ÖV) nicht oder nur beschränkt nutzen, zum Beispiel weil sie eine Geh- oder Sehbehinderung haben. Um dennoch am öffentlichen Leben teilzuhaben, sind die Betroffenen auf ÖV-ergänzende Fahrdienste angewiesen. Verschiedene Versicherungen zum Beispiel die Krankenkassen, Invalidenversicherung (IV) und Alters- und Hinterbliebenenversicherung (AHV) beteiligen sich teilweise an den Fahrkosten. Ebenso finanzieren Stiftungen im Auftrag einzelner Kantone Fahrdienste mit. Allerdings sind die Zuständigkeiten dieser Kostenträger oft nicht geklärt und die Leistungen zweckgebunden sowie begrenzt, so etwa auf eine bestimmte Anzahl Fahrten pro Monat.
Wie die Betroffenen diese Einschränkungen erleben und wie sich diese auf ihre Möglichkeiten zu arbeiten oder sozialen Aktivitäten nachzugehen auswirkt, ist bisher wenig bekannt. Die Betroffenensicht ist jedoch relevant, unter anderem auch, da die Schweiz im Rahmen der UNO-Behindertenrechtskonvention sowie des Behindertengleichstellungsgesetzes (BehiG) verpflichtet ist, die persönliche Mobilität von Menschen mit Behinderungen zu erleichtern.
Zielsetzung
Ziele dieses Forschungsprojekts waren
- Die Erstellung einer Übersicht zu nationalen/kantonalen Regelungen für ÖV-ergänzende Fahrdienste.
- Die Beschreibung erlebter Einschränkungen und Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung in diesem Bereich.
- Die Erstellung von Handlungsempfehlungen und konkreten Lösungsvorschlägen für politische Entscheidungstragende und Verantwortliche relevanter Organisationen.
Methode und Vorgehen
Das Projektteam erfasste die Sicht von Menschen mit Behinderung aus verschiedenen Perspektiven und mit mehreren Methoden:
- Als erstes wurden Erfahrungen von 31 Betroffenen in fünf Gruppendiskussionen qualitativ erhoben.
- Die Erkenntnisse der qualitativen Erhebung dienten als Grundlage für eine gross angelegte quantitative Befragung in der deutsch-, französisch- und italienischsprachigen Schweiz, an der 536 Personen teilnahmen.
- Gleichzeitig erstellte das Forschungsteam eine Übersicht über die gesetzlichen Grundlagen der ÖV-ergänzenden Mobilität in der Schweiz.
- Basierend auf dieser Übersicht sowie den Ergebnissen der qualitativen und quantitativen Erhebung entwickelten die Forschenden Handlungsempfehlungen und bezogen dabei relevante Stakeholder mit ein.
Ergebnisse
Insgesamt nahmen 594 Menschen mit und ohne Behinderung an den Studien des Projektes teil. Davon waren 336 (57%) Frauen, 256 (43%) Männer und zwei anderen Geschlechts. Die Teilnehmer:innen waren zwischen 18 und 103 Jahren alt (m=62,4, SD=19,6).
Die Ergebnisse zeigen, dass ÖV-ergänzende Fahrdienste zu unterschiedlichen Zwecken genutzt werden: für Therapie- und Arztbesuche, Freizeitaktivitäten, Einkäufe oder Arbeitswege. Hauptsächlich werden Fahrdienste für kurze Strecken eingesetzt. Der Service der Fahrdienste wird besonders wegen der persönlichen Betreuung von Fahrer:innen, der Verlässlichkeit und Sicherheit geschätzt. Die Nutzung der Fahrdienste variiert je nach Person. Während einige auf alternative Fahrdienste zurückgreifen können, sind ÖV-ergänzende Fahrdienste für andere die einzige Option. Folglich wirken sich gerade für diese Personen die hohen Preise, unklare Finanzierungszuständigkeit, begrenzte Verfügbarkeiten und ungenügende überkantonale Koordination einschränkend aus. Insgesamt ist die rechtliche Verortung von ÖV-ergänzenden Fahrdiensten unklar und die Zuständigkeit von Bund und Kanton nicht eindeutig.
Zusammenfassend schätzen Menschen mit Behinderung das Angebot der ÖV-ergänzenden Fahrdienste als eine wichtige Unterstützung für die Ausführung ihrer täglichen Aktivitäten und die gesellschaftliche Partizipation. Dennoch sind Grundrechte von Menschen mit Behinderung tangiert und die Ziele der Behindertenrechtskonvention im Bereich der Mobilität nicht erfüllt. Daraus resultieren folgende Handlungsempfehlungen:
- Ausweitung des Geltungsbereichs des Bundesgesetzes über die Beseitigung von Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung (BehiG) auf ÖV-ergänzende Fahrdienste.
- Einbindung der ÖV-ergänzenden Fahrdienste in den ÖV, indem sie dem Bundesgesetz über die Personenbeförderung (PBG) unterstellt werden.
- Sicherstellung einer schweizweiten Koordination von ÖV-ergänzenden Fahrdiensten in den Bereichen Angebot, Nutzung, Bestellung und Bezahlung.
Die vollständigen Resultate finden Sie im Abschlussbericht
Publikationen und Berichte
- Ungenügende Unterstützung für die Mobilität von Menschen mit Behinderung Medienmitteilung zhaw, 3.11.2023
- Die vergessene Kundschaft Beitrag in zhaw-Impact, 01-2022
ZHAW Publikationendatenbank
-
Egger, Selina Marita; Gemperli, Armin; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gantschnig, Brigitte,
2025.
Gleichberechtigte Mobilität für Menschen mit Behinderungen?[Paper].
In:
Public Health³ Österreich – Deutschland – Schweiz, Bregenz, Österreich, 24.-25. Januar 2025.
-
2024.
Zenodo.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.5281/zenodo.10814269
-
Egger, Selina Marita; Gemperli, Armin; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gantschnig, Brigitte,
2024.
In:
1st Occupational Therapy Europe Congress, Krakow, Poland, 15-19 October 2024.
-
Egger, Selina Marita; Gantschnig, Brigitte; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin,
2024.
Journal of Transport & Health.
38(101856).
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1016/j.jth.2024.101856
-
Egger, Selina; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin; Gantschnig, Brigitte,
2024.
Handlungsoptionen für eine inklusive Mobilität[Poster].
In:
6. Kongress der Ergotherapie, Fribourg, Schweiz, 24.-25. Mai 2024.
Winterthur:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-30946
-
Egger, Selina Marita; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin; Gantschnig, Brigitte,
2024.
Inklusion durch gleichberechtigte Mobilität für Menschen mit Behinderungen.
In:
6. Kongress der Ergotherapie, Fribourg, Schweiz, 24.-25. Mai 2024.
-
Gantschnig, Brigitte E.; Egger, Selina M.; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin,
2023.
Winterthur:
ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.21256/zhaw-2490
-
Egger, Selina Marita; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin; Gantschnig, Brigitte,
2023.
Gleichberechtigte Mobilität dank ÖV-ergänzender Fahrdienste?.
In:
Fachtagung für Dienstleistungsverantwortliche des Rotkreuz-Fahrdienstes aus den Kantonalverbänden, Olten, Schweiz, 25. Mai 2023.
-
Filippo, Martina; Egger, Selina Marita; Liechti, Ronald; Gemperli, Armin; Gantschnig, Brigitte,
2023.
Through transportation to participation : experiences in using paratransit services.
In:
16th Nordic Network on Disability Research Conference (NNDR), Reykjavik, Iceland, 10 - 12 May 2023.
-
Egger, Selina Marita; Gantschnig, Brigitte Elisabeth; Filippo, Martina,
2022.
Die Rechte von Menschen mit Behinderungen berücksichtigen.
Ergotherapie.
2022(8).
-
Egger, Selina Marita; Gemperli, Armin; Filippo, Martina; Liechti, Ronald; Gantschnig, Brigitte Elisabeth; et al.,
2022.
The experiences and needs of persons with disabilities in using paratransit services.
Disability and Health Journal.
15(4), S. 101365.
Verfügbar unter: https://doi.org/10.1016/j.dhjo.2022.101365
Projektorganisation
- Projektleitung
Prof. Dr. phil. Brigitte Gantschnig - Projektdauer
Februar 2021 - Dezember 2023 - Projektteam
Prof. Dr. phil. Brigitte Gantschnig, Leiterin Forschungsstelle Ergotherapie ZHAW
Dr. Ronald Liechti, Geschäftsführer Stiftung BTB
Dr. Martina Filippo, Wissenschaftliche Mitarbeiterin Zentrum für Sozialrecht, ZHAW School of Management and Law
Dr. Selina Egger, Ergotherapeutin MSc, Forschungsstelle Ergotherapie ZHAW
Thomas Ballmer, Ergotherapeut MSc, wissenschaftlicher Mitarbeiter Forschungsstelle Ergotherapie ZHAW
Prof. Dr. Armin Gemperli, Universität Luzern, Professor in Gesundheitswissenschaften - Projektpartner
Behindertentransporte Kanton Bern (BTB)
ZHAW School of Management and Law
AGILE.CH
Pro Infirmis
Universität Luzern - Finanzierung
Eidgenössische Büro für die Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen EBGB
Behindertentransporte Kanton Bern (BTB)
Pro Infirmis - Projektstatus
Durchführung
Projektpartner/-finanzierer
Das könnte Sie auch interessieren
Publikationen Ergotherapie
Alle Publikationen des Instituts für Ergotherapie in chronologischer Reihenfolge.
Institut für Ergotherapie
Aus-, Weiterbildung, Dienstleistung und Forschung in der Ergotherapie.
Publikationen Ergotherapie
Institut für Ergotherapie
Forschungsbericht
Alle Publikationen des Instituts für Ergotherapie in chronologischer Reihenfolge.
Aus-, Weiterbildung, Dienstleistung und Forschung in der Ergotherapie.
Die Forschungsbroschüre zum Schwerpunkt «Gesundheit im Alter»