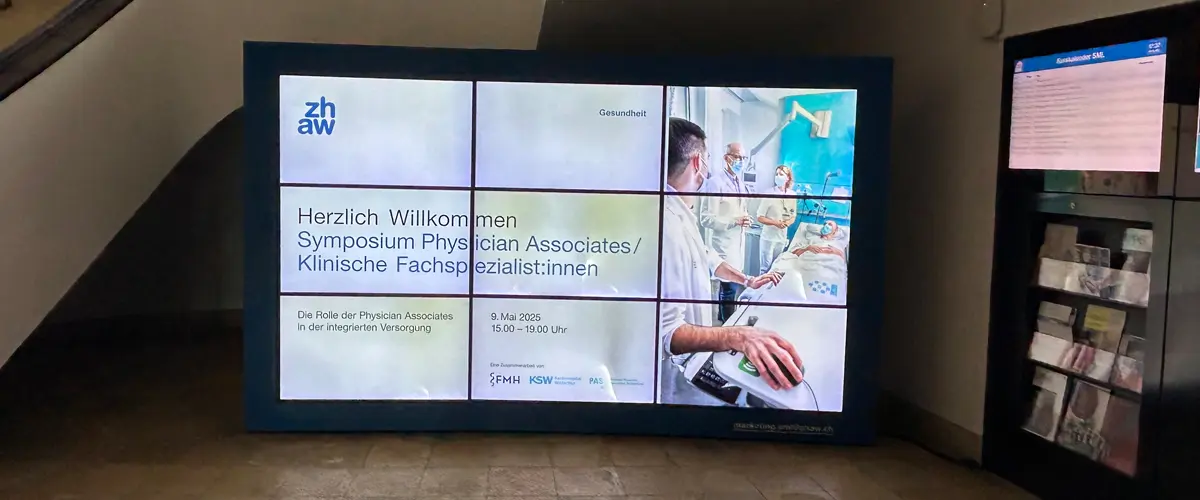Physician Associates stärken die integrierte Versorgung
Grosses Interesse am ZHAW-Symposium «Physician Associates / Klinische Fachspezialist:innen» zur Rolle von Physician Associates (PA) in der integrierten Versorgung: Rund 160 Fachpersonen diskutierten am Freitag, 9. Mai 2025, über die Chancen, Herausforderungen und Perspektiven des Berufsbildes.
Sie führen Eintrittsuntersuchungen bei Patient:innen durch, schreiben Arztberichte, begleiten Verlaufskontrollen oder kümmern sich um die Nachsorge: Klinische Fachspezialist:innen, auch bekannt als Physician Associates (PA), sind erfahrene Gesundheitsfachpersonen mit vertiefter klinischer Ausbildung. Sie arbeiten eng mit den Ärzt:innen im Spital, in Pflege- und Rehazentren, in der Hausarztpraxis oder weiteren Bereichen der integrierten Versorgung zusammen und übernehmen delegierte medizinische Aufgaben. In der Schweiz ist das Berufsbild noch wenig bekannt, aber es birgt grosses Potenzial angesichts des Fachkräftemangels und der wachsenden Komplexität im Gesundheitswesen. Die Rolle der PA in der integrierten Versorgung war auch zentrales Thema am ZHAW-Symposium vom Freitag, 9. Mai 2025, das vom Departement Gesundheit in Kooperation mit dem Kantonsspital Winterthur, der Ärztegesellschaft FMH und dem Institut für Public Health der ZHAW bereits zum 5. Mal organisiert wurde. Wie aktuell das Thema ist, zeigte das grosse Interesse an der Veranstaltung. Rund 160 Personen, darunter zahlreiche PA und angehende PA, waren ins Volkartgebäude in Winterthur gekommen, um mit Expert:innen aus Praxis, Wissenschaft, Tarifrecht und Bildung über Chancen, Herausforderungen und Perspektiven zu sprechen. Moderiert wurde der Anlass von Claudia Sedioli Maritz.
Unterschiede in der Ausbildung
In einem ersten Teil gaben Quinten van den Driesschen, PA in den Niederlanden, und Prof. Dr. Peter Heistermann vom Deutschen Hochschulverband Physician Assistant (DHPA) Einblick in den Entwicklungsstand des Berufsbildes in ihren Ländern. Dabei wurde deutlich: Einer der grössten Unterschiede liegt in der Ausbildung. In der Schweiz absolvieren Physician Associates eine Weiterbildung (CAS oder MAS) aufbauend auf einer HF-Ausbildung oder eines Bachelors in einem Gesundheitsberuf. In Deutschland hingegen handelt es sich um ein Hochschulstudium mit Bachelorabschluss und in den Niederlanden um ein Masterstudium mit praktischer Ausbildung im Betrieb. Für Peter Heistermann war die Akademisierung des Berufsbildes ein wichtiger Schritt für die Positionierung und Anerkennung in Deutschland. Er bedauert aber, dass es in seinem Land kein Berufsgesetz gibt. Deshalb sei eine Selbstverpflichtung der Fachverbände von grosser Bedeutung, sagte er. In den Niederlanden ist die Profession seit einigen Jahren ein rechtlich verankertes Berufsbild. PA würden vergütet und seien von medizinischen Räten anerkannt, so Quinten van den Driesschen.
In der Schweiz arbeitet die ZHAW gemeinsam mit der FMH und weiteren Fachverbänden, als Ergänzung zu der sehr gut besuchten Weiterbildung (CAS oder MAS), seit längerem an der Einführung eines Bachelorstudiengangs für PA. «Wir haben ein Curriculum erarbeitet und wären bereit», sagte Prof. Dr. Andreas Gerber-Grote, Direktor des Departements Gesundheit der ZHAW. «Im Moment hoffen wir auf ein baldiges grünes Licht der politischen Entscheidungsträger für den Start eines solchen BSc Physician Associate, denn von der Praxis bekommen wir viele Anfragen.»
«Kein Ersatz, aber eine sinnvolle Ergänzung»
Wie wichtig und wertvoll PA sind, zeigten drei Praxisbeispiele. Karin Steele und Magalie Mettler arbeiten seit eineinhalb Jahren respektive seit vier Monaten als PA in einer Hausarztpraxis. Ihre Erfahrungen sind hauptsächlich positiv. «In der hausärztlichen Praxis bieten PA eine innovative Lösung zur Unterstützung der ambulanten Gesundheitsvorsorge», sagte Karin Steele. «Sie ersetzen die Ärzteschaft nicht, sondern ergänzen ihre Arbeit auf sinnvolle Weise und entlasten so die Praxis.» Allerdings, fügte Magalie Mettler an, sei es wie bei jedem neuen Konzept: «Es braucht klare Strukturen, gute Kommunikation und vor allem Zeit, um hineinzuwachsen.»
Auch Judith Weiss ist vom Beruf überzeugt. Sie arbeitet seit mehreren Jahren als PA im Bereich der Langzeitpflege und ist mittlerweile Vorstandsmitglied des Berufsverbands Physician Associate Switzerland. Der damalige Chefarzt der Einrichtung, in der sie heute arbeitet, entschied sich vor neun Jahren aufgrund des Mangels an Ärzt:innen, vier PA auszubilden. Judith Weiss war eine davon. «Wir haben über die Jahre eine äusserst tragfähige Lösung aufgebaut», sagt sie rückblickend. Ihr damaliger Chef habe es treffend formuliert: «Gute Versorgung braucht manchmal neue Wege.»
Im dritten Praxisbeispiel stellt Nadine Koller ihre Aufgaben in einer Rehabilitationsklinik mit Schwerpunkt auf muskuloskelettalen und internistischen Krankheitsbildern vor. In ihrer Funktion übernimmt sie unter anderem Eintrittsassessments, die Vorbereitung und Durchführung von Visiten, die medizinische Dokumentation sowie das Austrittsmanagement. Die enge Zusammenarbeit mit Ärzteschaft, Pflege und Therapieteams sowie strukturierte Prozesse sind die Basis für effiziente und wirksame Prozesse.
Eine Herausforderung bleibt
In der abschliessenden Podiumsdiskussion, an der Judith Weiss, Prof. Dr. Peter Heistermann, Christine Boldi, Rechtsanwältin und Tarifexpertin im Gesundheitsrecht, sowie Dr. Richard Mansky, Oberarzt am USZ und Mitglied des Verbands der Assistenz- und Oberärzt:innen Zürich, teilnahmen, herrschte weitgehend Einigkeit über die bedeutende Rolle der PA in der integrierten Versorgung. Trotzdem bleibt eine grosse Herausforderung bestehen: Die Berufsgruppe ist in der Öffentlichkeit – und selbst innerhalb der Fachwelt – noch zu wenig bekannt. «Der Beruf der PA muss sichtbarer, attraktiver und auch für junge Menschen greifbarer werden», lautete der Tenor der Diskussion. «Und dabei könnte die Einführung eines Bachelorstudiengangs viel helfen.»