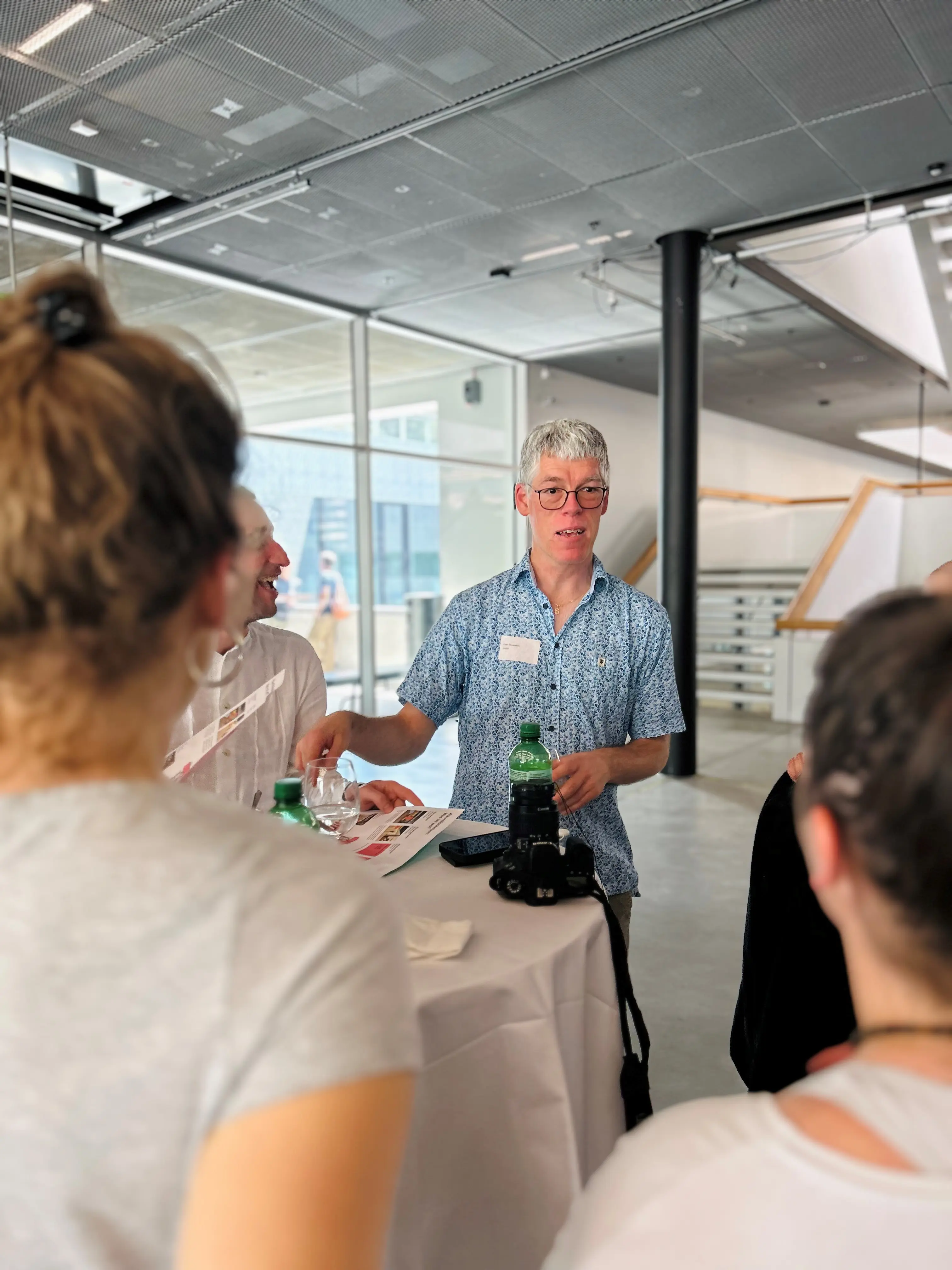Selbst- und Mitbestimmung in der Arbeitsintegration
Am Mittwoch, 12. Juni 2024 fand die 2. Zürcher Fachtagung Arbeitsintegration im Toni-Areal statt. Im Fokus stand die Förderung der Selbst- und Mitbestimmung der Adressat:innen.

Vernetzung und Dialog
Im Raum Zürich existiert eine grosse Vielfalt von Angeboten und Organisationen der Arbeitsintegration. Die Tagung fördert die Vernetzung von Fachpersonen über verschiedene Praxisfelder hinweg und pflegt einen Dialog zwischen Praxis und Hochschule. Sie gibt Praxisorganisationen die Gelegenheit, ihre Erfahrungen und Ansätze zur Diskussion zu stellen.
Nach der ersten Durchführung von 2022 fand am 12. Juni 2024 die 2. Zürcher Fachtagung Arbeitsintegration im Toni-Areal mit ca. 100 Teilnehmer:innen statt. Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe (SEB) der Stadt Zürich steuerten als Schlüsselpartnerin der Fachtagung nicht nur einen Workshop bei, sondern sorgten durch die Verpflegung auch für das leibliche Wohl der Gäste.
Vom Berufskodex zur konkreten Praxis
Daniela Wirz, Leiterin der Fachstelle Praxiskooperationen und internationale Beziehungen der ZHAW Soziale Arbeit, führte in die Thematik ein. Sie stellte heraus, wie zentral die Förderung der Selbst- und Mitbestimmung der Adressat:innen im Berufskodex der Sozialen Arbeit ist. Sie hielt fest, dass selbst unter politischen Rahmenbedingungen, welche die individuelle Entscheidungsfreiheit einschränken, Spielräume für Mitbestimmung genutzt werden können. Sie gab jedoch auch zu bedenken, dass unter trendigen Leitbegriffen wie Autonomie und Partizipation nicht selten an den Bedürfnissen der Betroffenen vorbei gehandelt wird oder Ziele verfolgt werden, die aus professionsethischer Sicht fragwürdig sind. Es ist deshalb wichtig, auf die Ebene der konkreten Praxis zu gehen und zu fragen, welche Formen der Selbst- und Mitbestimmung bei einer bestimmten Zielgruppe in einem spezifischen Kontext sinnvoll und wirksam sind.
Voneinander lernen
Annina Studer und Rocco Brignoli von INSOS Schweiz berichteten von ihren Erfahrungen bei der Umsetzung der UNO-Behindertenrechtskonvention. In ihrem Projekt über betriebliche Mitwirkung stellte sich heraus, dass es nicht die eine richtige Lösung für alle Fälle gibt. Wichtig ist bei diesem Zulassen von Vielfalt neben der Passung für Zielgruppen und Praxisorganisation eine Haltung, die Mitwirkung als Prozess versteht, der nicht von A bis Z geplant werden kann. Fehler sind unvermeidlich und lehrreich. Die beiden Referent:innen äusserten die Hoffnung, dass der Funke der Selbst- und Mitbestimmung auf Organisationen und Praxisfelder hinüberspringt, deren Adressat:innen nicht Menschen mit Behinderungen sind.
Vielfältige Modelle
Nach dem Mittagessen verteilten sich die Teilnehmer:innen der Tagung auf sechs Workshops, die durch Praxisorganisationen angeboten wurden. Die Workshops spiegelten die grosse Vielfalt der Praxisfelder und Modelle der Arbeitsintegration. Bei der Fachstelle für Arbeitsintegration wintegra stand das Potenzial interkultureller Coachingsperspektiven im Zentrum. Das Werkheim Uster stellte das neue Modell «Mehrwerk» vor. Der Läbesruum erläuterte die Bedeutung einer Haltung, die Adressat:innen nicht als Klient:innen, sondern als Mitarbeitende anspricht. Impulsis präsentierte Good Practice von Mitbestimmung durch Jugendliche mit Mehrfachproblematiken. Die Sozialen Einrichtungen und Betriebe (SEB) der Stadt Zürich stellten ein Mitbestimmungsprojekt in Kooperation mit der ZHAW vor. Und das SAH Zürich thematisierte Ansätze zur Selbst- und Mitbestimmung in einem Qualifizierungsprogramm für junge Mütter ohne Erstausbildung.
Aus eigener Erfahrung
Abschliessender Höhepunkt der Tagung war das Podium mit fünf Selbstvertreter:innen. Die Podiumsteilnehmer:innen Shishai Haile, Heini Hassler, Kivanc Ilker, Andrea Jerger und Marianne Rossel brachten Erfahrungen ein, die den allermeisten Fachpersonen fehlen: Es gibt kaum Coaches, Sozialarbeiter:innen oder Institutionsverantwortliche, die selbst Sozialhilfe bezogen haben, aus ihrer Heimat geflohen sind oder von einer IV-Rente leben. Die authentischen und pointierten Wortmeldungen der Podiumsteilnehmer:innen sorgten für einige Lacher, brachten das Fachpublikum stellenweise aber auch in Verlegenheit. «Keine Angst, wir beissen nicht», lautete die Botschaft vom Podium, als sich aus dem Saal niemand zu Wort meldete. Aber auch: «Nicht ohne uns über uns» oder «Es könnten viele Ressourcen gespart werden, wenn mehr auf uns gehört würde.» Dabei wurde sehr deutlich, dass Selbst- und Mitbestimmung nicht einfach nur formal geregelt werden können, sondern bei der Arbeit oder in Beratungssituationen durch Augenhöhe und Würdigung von Biografien und Erfahrungen gelebt werden müssen. Auch die ZHAW hat noch Luft nach oben beim Einbezug des Wissens von Adressat:innen in Projekte oder Lehrveranstaltungen.
Downloads
Inputreferate
- Präsentation des Inputreferats von Daniela Wirz: «Selbst-und Mitbestimmung in der Arbeitsintegration. Was ist das und wie geht das?» (PDF 366 kB)
- Präsentation des Inputreferats von Rocco Brignoli und Annina Studer: «Von der Selbstbestimmung in die Mitwirkung. Arbeitnehmenden-Vertreter:innenin Integrationsbetrieben» (PDF 5.36 MB)