50 Jahre Cultural Economics: Die Association for Cultural Economics International (ACEI) als Katalysator für zukunftsweisende Forschung in Kunst und Kultur
Die 23. Konferenz der Association for Cultural Economics International (ACEI) an der Erasmus University in Rotterdam feierte 50 Jahre Kulturökonomie unter dem Dach der Assoziation. Beim Abschlusspanel reflektierten und diskutierten die renommierten Wissenschaftler:innen Prof. John O’Hagan, Prof. David Throsby, Prof. Michael Hutter, Prof. Ilde Rizzo und Prof. Hans Abbing über die Entwicklung der Disziplin in den vergangenen fünf Jahrzehnten – und skizzierten Wünsche und Szenarien für ihre Zukunft. Moderiert wurde das Panel „50 Years of Cultural Economics: Reflections & Future Directions" von unserer Seniorwissenschaftlerin Dr. Laura Johanna Noll.

Dass Ökonom:innen sich mit Kunst und Kultur beschäftigen ist keineswegs neu. Schon vor langer Zeit untersuchte einer von ihnen Kunstmärkte, Mode und ästhetische Urteile und fragte sich, warum Menschen Kunst kaufen. Dieser Ökonom beobachtete, dass der Geschmack und die Nachfrage nach Kunst stark von sozialen Normen abhängen und von „Gewohnheit und Mode beeinflusst werden, Prinzipien, die ihre Herrschaft über unsere Urteile über Schönheit jeder Art ausdehnen“. Er überlegte auch, wer ein innovativer, „bedeutender“ Künstler ist, und stellte fest, dass „ein bedeutender Künstler eine beträchtliche Veränderung in den etablierten Formen jeder dieser Künste herbeiführt und eine neue Mode in der Schriftstellerei, der Musik oder der Architektur einführt“.
Wer war dieser Wirtschaftswissenschaftler? Adam Smith! Vor 260 Jahren.
Die Frage, welchen Wert Kultur hat – ökonomisch, sozial, symbolisch – betrifft uns alle. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Transformation durch Digitalisierung, Klimawandel oder geopolitische Krisen bietet die Kulturökonomie wichtige Perspektiven: Sie hilft zu verstehen, wie Kultur als Ressource für soziale Kohäsion, Innovation und wirtschaftliche Entwicklung wirken kann.
Die Kulturökonomie – oder Cultural Economics – ist ein interdisziplinäres Forschungsfeld, das sich mit der ökonomischen Analyse von Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft beschäftigt. Sie untersucht unter anderem, wie kulturelle Güter produziert, verteilt und konsumiert werden, wie sich Märkte für Kunstwerke, Musik, Theater und Film entwickeln, welche Rolle die Kulturförderung sowie -politik spielen und wie sich kulturelle Werte in ökonomischen Modellen abbilden lassen.
In den letzten Jahrzehnten hat sich das Feld weiterentwickelt: Neben klassischen Themen rücken neue Fragestellungen, digitale Datenquellen sowie ausgefeiltere ökonom(etr)ische und soziologische Methoden in den Fokus. Fünf international führende Wissenschaftler:innen, die diese Entwicklung nicht nur begleitet, sondern massgeblich mitgestaltet haben, reflektierten:


Prof. John O’Hagan – Die Assoziation als Katalysator für Forschung und Austausch
Prof. John O’Hagan vom Trinity College Dublin gilt als eine der Gründungsfiguren der Kulturökonomie. Seine Forschung reicht von darstellender Kunst über Museen und Künstler:innenmigration bis hin zur räumlichen Konzentration kreativer Talente. In den letzten Jahren widmete er sich der Orchesterlandschaft und dem Verhalten von Konzertpublikum. In seiner Reflexion blickte John auf zahlreiche ACEI-Konferenzen zurück und betonte die Rolle der Assoziation als Katalysator für Forschung und internationalen Austausch. Besonders hob er hervor, dass sein grösster Beitrag womöglich in der Förderung seiner zahlreichen Doktorand:innen liegt – darunter auch der diesjährige Präsident der ACEI, Prof. Karol Borowiecki.

Prof. Hans Abbing – Zwischen Kunst und Ökonomie als Künstler und Professor
Prof. Hans Abbing von der Erasmus Universität in Rotterdam ist sowohl Ökonom als auch praktizierender Künstler. Bekannt wurde er durch seine kritische Auseinandersetzung mit der Einkommenssituation von Künstler:innen – sein Buch Why Are Artists Poor? (2002) gilt als Standardwerk. In Rotterdam sprach er über den Wandel der Disziplin hin zu digitalen Inhalten und stellte die Frage, wie wir in Zukunft Kunst und Künstler:innen definieren. Er prognostizierte eine zunehmende Relevanz populärer Kunstformen und eine Verschiebung der Förderlogiken hin zu digitalen Projekten.

Prof. Michael Hutter – Kunstsoziologische Perspektive auf Kreativität, Netzwerke und Werte
Prof. Michael Hutter vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) ist für seine interdisziplinäre Forschung zu Kreativität, Innovation und Wertentstehung bekannt. In seiner Reflexion blickte er auf die frühen ACEI-Konferenzen der 1990er Jahre zurück, darunter die von ihm organisierte Konferenz 1994. Er sprach über seinen Übergang von der Kunstökonomie zur Kunstsoziologie und betonte die Bedeutung von Netzwerken, positiven Feedbackschleifen und experimenteller Theorieentwicklung für das Verständnis kultureller Märkte. Sein gemeinsam mit David Throsby herausgegebenes Buch Beyond Price (2008) gilt als Meilenstein in der Theorie über den Wert und Preis von Kunst. Hutter warnte davor, sich bei der Forschung zu sehr auf die vielfach verfügbaren und daher attraktiven Auktionsdaten zu konzentrieren – der Primärmarkt, Künstler:innen und Galerien dürften nicht aus dem Blick geraten.

Prof. Ilde Rizzo – Kulturpolitik, Kulturerbe und lokale Entwicklung
Prof. Ilde Rizzo von der Universität Catania in Sizilien ist eine führende Expertin für öffentliche Finanzen und Kulturökonomie. Ihre Forschung konzentriert sich auf Kulturerbe, Kulturtourismus und Institutionenökonomie. Besonders interessiert sie sich für kulturelle Institutionen wie Museen, Bibliotheken und Archive sowie für den Zusammenhang zwischen Kultur und regionaler Entwicklung. In ihrer Reflexion stellte sie einen konzeptionellen Rahmen vor, der die Rolle von Kultur für wirtschaftliches Wachstum beleuchtet. Sie plädierte für eine stärkere Verbindung zwischen ökonomischer Theorie und kulturpolitischer Praxis – insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Entwicklung und sozialen Zusammenhalt. Auf der Konferenz wurde sie für ihre Leistungen als Ehrenmitglied (Honorary Fellow) der Assoziation ausgezeichnet.
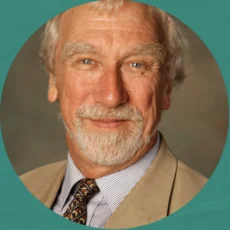
Prof. David Throsby – Kulturkapital, politische Wirkung und Nachwuchswissenschaftler:innen
Prof. David Throsby von der Macquarie University in Sydney gehört zu den meistzitierten Wissenschaftlern der Disziplin. Seine Konzepte – etwa das des kulturellen Kapitals, das Modell der „konzentrischen Kreise“ oder die Idee des Künstlers als „dual-motivated agent“ – haben sowohl die akademische Debatte als auch internationale Kulturpolitik massgeblich geprägt. In seiner abschliessenden Reflexion blickte er auf die Gründung der ACEI in Akron (USA) zurück und betonte die Notwendigkeit, die Disziplin offen für neue Themen und Methoden zu halten. Besonders hob er die Rolle junger Forscher:innen hervor, die zur Weiterentwicklung der Kulturökonomie beitragen.

Dr. Laura Johana Noll – Preise, Sammler:innen und nachhaltiges Management
Dr. Laura Johanna Noll forscht am ZHAW Zentrum für Kulturmanagement zur ökonomischen Analyse in der Bildenden Kunst. Sie beschäftigt sich insbesondere mit der Wert- und Preisentstehung von Kunstwerken, den Motiven von Kunstsammler:innen und dem strategischen und nachhaltigen Management von Kunstinstitutionen. Die Arbeit der Panelist:innen hat ihr Denken und ihre Forschung massgeblich geprägt.

Die Diskussion mit den Panelist:innen zeigte: Die Kulturökonomie steht heute vor einer Vielzahl neuer Forschungsfragen und -methoden, die durch technologische Innovationen und veränderte Marktstrukturen angestossen werden.
Plattformbasierte Geschäftsmodelle verändern Wertschöpfungsketten in der Kulturproduktion. Fragen nach Vergütungsmodellen, Sichtbarkeit und Marktmacht rücken in den Vordergrund.
Die Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz (KI), Virtual Reality (VR) und Extended Reality (XR) auf kreative Prozesse, Publikumsverhalten und kulturelle Teilhabe rücken in den Fokus. Wie verändert sich künstlerische Autorschaft, wenn Kunstwerke von KI generiert werden? Welche neuen Formen der Immersion und Interaktion entstehen durch XR-Technologien?
Im Kunstinvestment gewinnen Trends wie Shared Ownership, Tokenisierung und Blockchain-basierte Märkte an Bedeutung. Diese Entwicklungen werfen grundlegende Fragen nach Renditen, Eigentum, Zugang, Vertrauen und Regulierung auf.
Im Kontext der globalen Nachhaltigkeitstransformation wird die Rolle von Kunst und Kultur zunehmend hervorgehoben. Wie kann ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit in kulturellen Institutionen verankert und darüber hinaus im gesamten Sektor gefördert und beschleunigt werden?
Angesichts wachsender gesellschaftlicher Herausforderungen wird Kulturpolitik zunehmend als strategisches Handlungsfeld verstanden. Wie kann Kulturpolitik inklusiver, partizipativer und evidenzbasierter gestaltet werden? Welche Instrumente braucht es, um kulturelle Teilhabe zu fördern, kreative Ökosysteme zu stärken und Innovation nachhaltig zu unterstützen? Und wie kann sie auf internationaler Ebene wirksam agieren, ohne lokale Kontexte aus dem Blick zu verlieren?
Die Kulturökonomie reagiert auf diese Dynamiken mit neuen theoretischen Konzepten, empirischen Studien, ökonom(etr)ischen Methoden und interdisziplinären Kooperationen. Sie wird zu einem Schlüsselbereich für das Verständnis kultureller Transformation im digitalen Zeitalter. All dies macht Lust auf weitere 260 Jahre Kunst- und Kulturökonomie.
PS: Den Link zu Association for Cultural Economics finden Sie hier.


